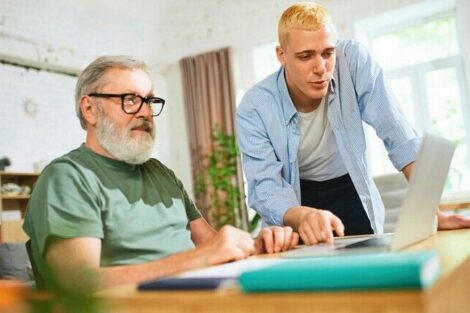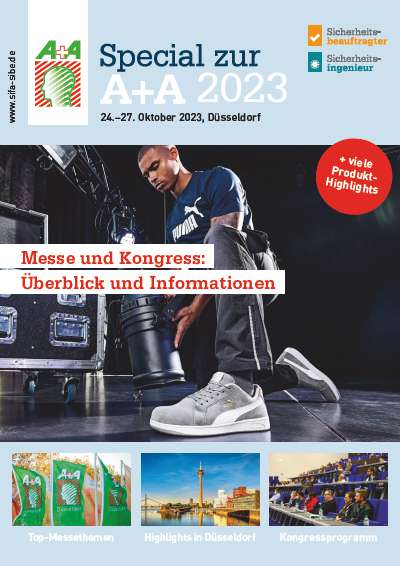Im Mai 2018 trat die neue Arbeitsstättenregel ASR A2.2 „Maßnahmen gegen Brände“ in Kraft. Technische Neuerungen im Bereich der Feuerlöschgeräte haben ebenso Eingang in das staatliche Arbeitsstättenregelwerk gefunden wie organisatorische Maßnahmen des betrieblichen Brandschutzes, die sich in der Praxis bereits bewährt haben, aber oft mit der Frage „Wo steht das?“
Unsere Webinar-Empfehlung
Es gibt viele Fälle, in denen die Fallhöhe für eine herkömmliche Absturzsicherung nicht ausreicht. Beispiele für Arbeiten in geringer Höhe sind z.B. der Auf- und Abbau von Gerüsten, die Wartung von Industrieanlagen und Arbeiten in Verladehallen sowie Anwendungen in der Bahn und…
Teilen:














 SibePlus-Beiträge und das große Archiv erhalten!
SibePlus-Beiträge und das große Archiv erhalten!