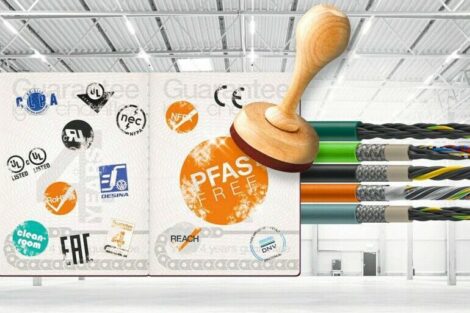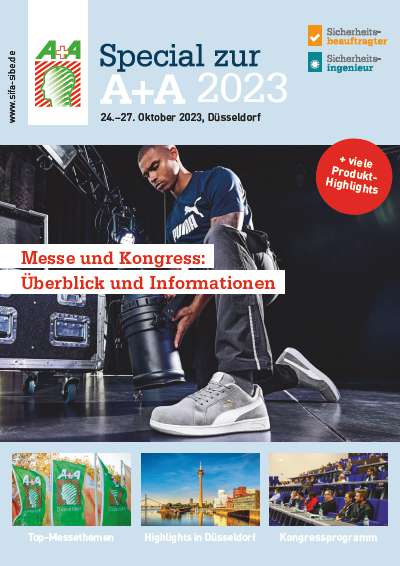Der Ausschuss für Arbeitsstätten (ASTA) hat in seiner Sitzung im Sommer 2012 weitere Arbeitsstättenregeln zur Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) abschließend diskutiert und beschlossen und neue Projekte für weitere Arbeiten an Arbeitsstättenregeln verabschiedet.
Aktuelle Weiterentwicklungen in der Arbeitswelt, insbesondere der Technik, müssen vom ASTA (s. Kasten „Der Arbeitsstättenausschuss“) frühzeitig
Unsere Webinar-Empfehlung
29.02.24 | 10:00 Uhr | Spielsucht, Kaufsucht, Arbeitssucht, Mediensucht – was genau verbirgt sich hinter diesen Begriffen? Wie erkennt man stoffungebundene Süchte? Welche Rolle spielt die Führungskraft bei der Erkennung, Vermeidung und Bewältigung von Suchtproblemen am Arbeitsplatz?…
Teilen:










 SifaPlus-Beiträge und das große Archiv erhalten!
SifaPlus-Beiträge und das große Archiv erhalten!