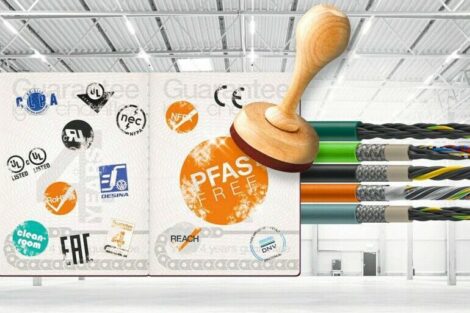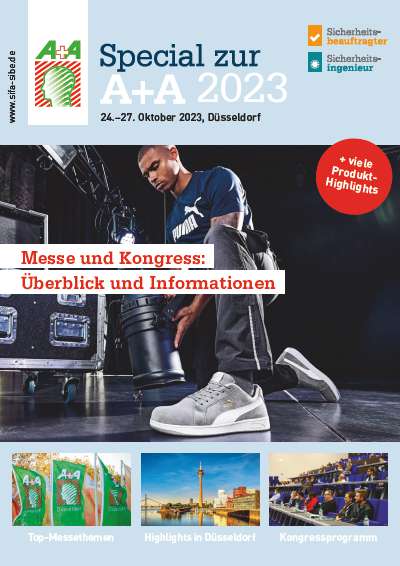Wenn es trotz aller Anstrengungen von Arbeitgebern und Sicherheitsingenieuren nicht dauerhaft funktioniert mit dem Arbeitsschutz, hat das meist tieferliegende Gründe, die mit dem Begriff „Kultur“ verbunden sind. In Teil I wurde am Beispiel von Forschungsbetrieben abgeleitet, warum kulturbedingte Unterschiede sowohl bei der Wahrnehmung als auch in der Kommunikation von
Unsere Webinar-Empfehlung
22.02.24 | 10:00 Uhr | Das Bewusstsein für die Risiken von Suchtmitteln am Arbeitsplatz wird geschärft, der Umgang mit Suchtmitteln im Betrieb wird reflektiert, sodass eine informierte Entscheidung über Maßnahmen zur Prävention von und Intervention bei Suchtmittelkonsum am Arbeitsplatz…
Teilen:











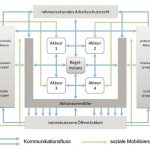

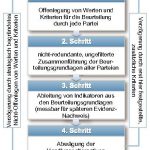
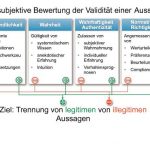

 SifaPlus-Beiträge und das große Archiv erhalten!
SifaPlus-Beiträge und das große Archiv erhalten!