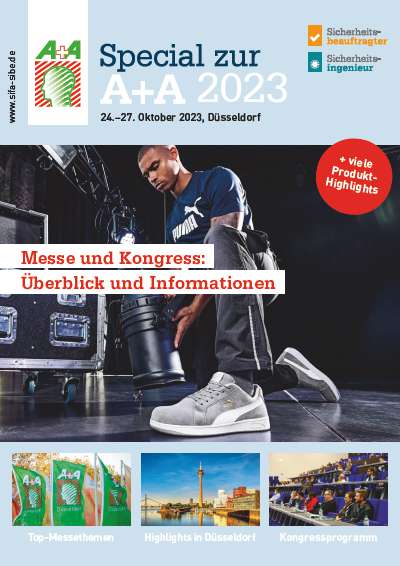Zugegebenermaßen mag es etwas übertrieben sein: Aber wohl kaum ein anderes Thema beim Konformitätsnachweis nach EG Maschinenrichtlinie (heute MRL 2006/42/EG) beinhaltet so viele Stolpersteine wie das Thema „Gesamtheit von Maschinen“, umgangssprachlich – auch heute noch – häufig als verkettete Maschinen oder maschinelle Anlagen o. ä. bezeichnet.
Unsere Webinar-Empfehlung
15.06.23 | 10:00 Uhr | Maßnahmenableitung, Wirksamkeitsüberprüfung und Fortschreibung – drei elementare Bausteine in jeder Gefährdungsbeurteilung, die mit Blick auf psychische Belastung bislang weniger Beachtung finden.
Teilen:













 SifaPlus-Beiträge und das große Archiv erhalten!
SifaPlus-Beiträge und das große Archiv erhalten!