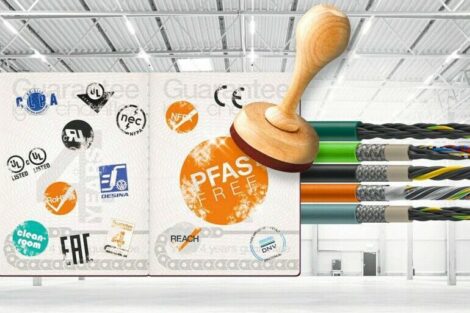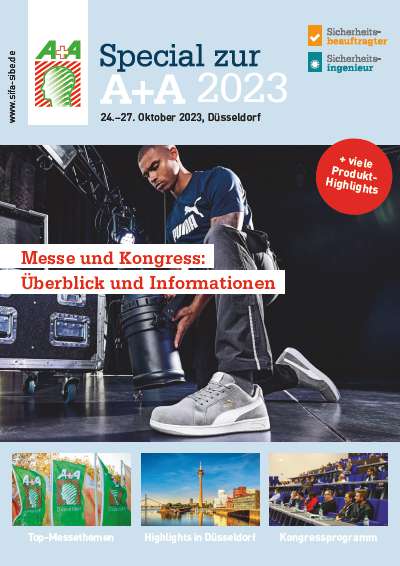Gesichtsformen variieren von Mensch zu Mensch. Es ist darum einleuchtend, dass es keine Atemschutzmaske geben kann, die bei jedem Träger gleich gut sitzt. Eine praxisnahe Hilfestellung bei der Auswahl der individuell passenden Maske geben qualitative oder quantitative Methoden zur Bestimmung des Maskendichtsitzes, so genannte Fit-Tests.
Dr.
Unsere Webinar-Empfehlung
22.02.24 | 10:00 Uhr | Das Bewusstsein für die Risiken von Suchtmitteln am Arbeitsplatz wird geschärft, der Umgang mit Suchtmitteln im Betrieb wird reflektiert, sodass eine informierte Entscheidung über Maßnahmen zur Prävention von und Intervention bei Suchtmittelkonsum am Arbeitsplatz…
Teilen:













 SifaPlus-Beiträge und das große Archiv erhalten!
SifaPlus-Beiträge und das große Archiv erhalten!