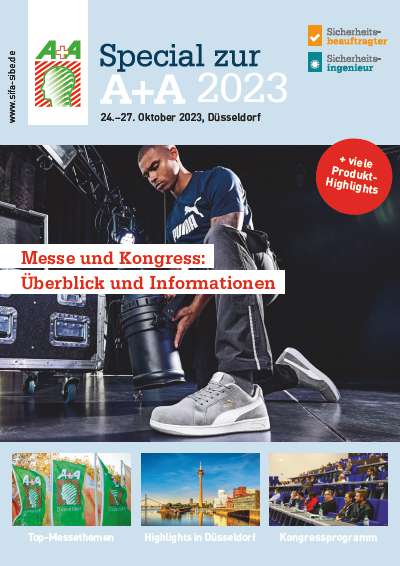Instrumente zur Erfassung psychischer Belastung sind nur Mittel zum Zweck. Ziel der Analyse und Bewertung von Arbeit ist deren menschengerechte Gestaltung. Die Ableitung geeigneter Maßnahmen ist z.B. Ziel der gesetzlich geforderten Gefährdungsbeurteilung [1], des betrieblichen Gesundheitsmanagements oder auch des Qualitätsmanagements.
Dr. rer. nat. Gabriele Richter
Unsere Webinar-Empfehlung
22.02.24 | 10:00 Uhr | Das Bewusstsein für die Risiken von Suchtmitteln am Arbeitsplatz wird geschärft, der Umgang mit Suchtmitteln im Betrieb wird reflektiert, sodass eine informierte Entscheidung über Maßnahmen zur Prävention von und Intervention bei Suchtmittelkonsum am Arbeitsplatz…
Teilen:











 SifaPlus-Beiträge und das große Archiv erhalten!
SifaPlus-Beiträge und das große Archiv erhalten!