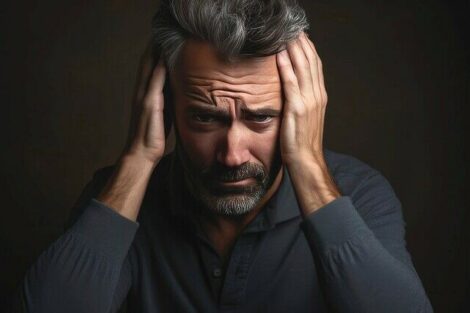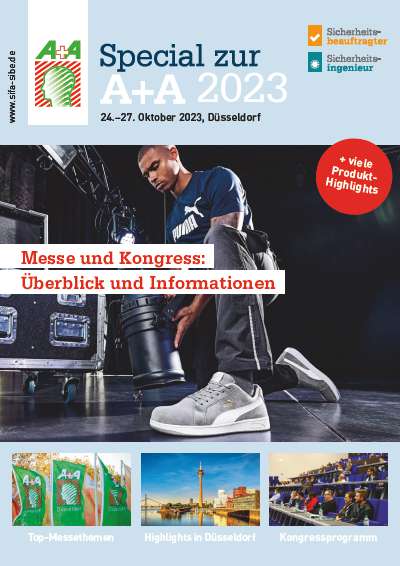Mit dem Störfall beim damaligen Schweizer Chemieunternehmen Sandoz in Basel am 1. November 1986 sind die Gefahren bei der Lagerung von Chemikalien in das Bewusstsein breiter Bevölkerungskreise gedrungen. Eine Konsequenz war die Einfügung von Regeln zur Löschwasser-Rückhaltung in die TRGS 514 „Lagern sehr giftiger und giftiger Stoffe in Verpackungen
Unsere Webinar-Empfehlung
Es gibt viele Fälle, in denen die Fallhöhe für eine herkömmliche Absturzsicherung nicht ausreicht. Beispiele für Arbeiten in geringer Höhe sind z.B. der Auf- und Abbau von Gerüsten, die Wartung von Industrieanlagen und Arbeiten in Verladehallen sowie Anwendungen in der Bahn und…
Teilen:









 SifaPlus-Beiträge und das große Archiv erhalten!
SifaPlus-Beiträge und das große Archiv erhalten!