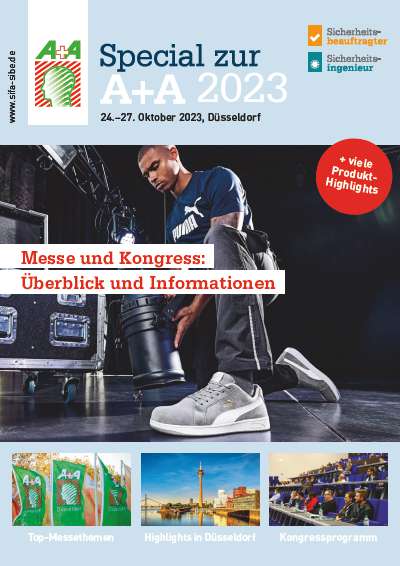„Schutz und Stärkung der Gesundheit bei arbeitsbedingter psychischer Belastung“, Kernziel der GDA-Periode von 2013 bis 2018, dürfte auch das Arbeitsschutzthema des kommenden Jahres 2014 sein.
Sabine Kurz
In der gesetzlich vorgeschriebenen Gefährdungsbeurteilung müssen Unternehmen zwar auch die psychischen Belastungen bei der Arbeit bewerten, doch
Unsere Webinar-Empfehlung
29.02.24 | 10:00 Uhr | Spielsucht, Kaufsucht, Arbeitssucht, Mediensucht – was genau verbirgt sich hinter diesen Begriffen? Wie erkennt man stoffungebundene Süchte? Welche Rolle spielt die Führungskraft bei der Erkennung, Vermeidung und Bewältigung von Suchtproblemen am Arbeitsplatz?…
Teilen:









 SifaPlus-Beiträge und das große Archiv erhalten!
SifaPlus-Beiträge und das große Archiv erhalten!