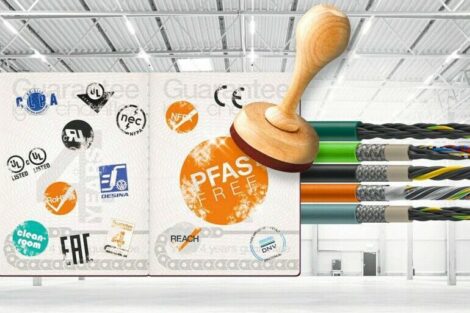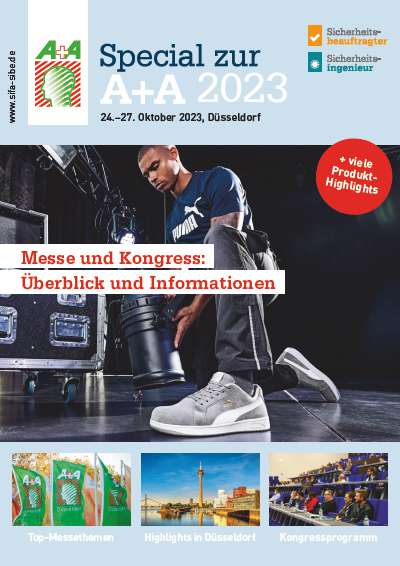Defekte Elektrogeräte stellen sowohl für die Arbeitnehmer als auch für Besucher, Kunden und andere Beschäftigte im Unternehmen eine Gefahr dar. Es ist die Pflicht des Arbeitgebers beziehungsweise Unternehmers für sichere Arbeitsmittel zu sorgen. Daher müssen elektrische Arbeitsmittel geprüft werden. Meist entledigen sich die Geschäftsführungen dieser Pflicht durch den Einsatz
Unsere Webinar-Empfehlung
15.06.23 | 10:00 Uhr | Maßnahmenableitung, Wirksamkeitsüberprüfung und Fortschreibung – drei elementare Bausteine in jeder Gefährdungsbeurteilung, die mit Blick auf psychische Belastung bislang weniger Beachtung finden.
Teilen:









 SifaPlus-Beiträge und das große Archiv erhalten!
SifaPlus-Beiträge und das große Archiv erhalten!