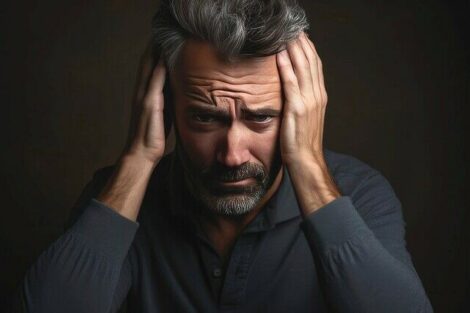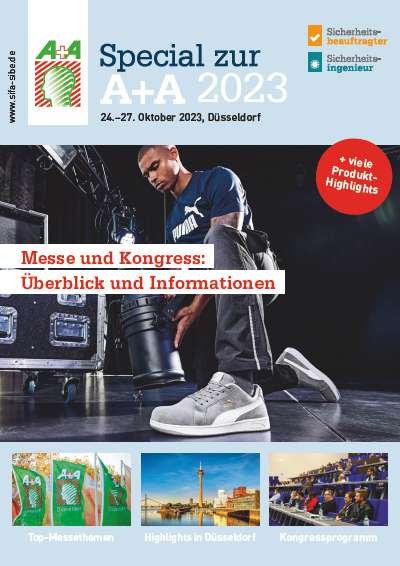Seit Mitte der 1980er-Jahre nimmt die Arbeitszufriedenheit in Deutschland ab. Eine Reihe neuerer wissenschaftlicher Untersuchungen geht der Frage nach dem Zusammenhang von Entlohnung und Arbeitszufriedenheit nach. Inwieweit hängt dies mit der Entlohnung zusammen? Welche Faktoren gibt es noch?
Ministerialrat Peter H. Niederelz
Rund zwei
Unsere Webinar-Empfehlung
15.06.23 | 10:00 Uhr | Maßnahmenableitung, Wirksamkeitsüberprüfung und Fortschreibung – drei elementare Bausteine in jeder Gefährdungsbeurteilung, die mit Blick auf psychische Belastung bislang weniger Beachtung finden.
Teilen:









 SifaPlus-Beiträge und das große Archiv erhalten!
SifaPlus-Beiträge und das große Archiv erhalten!