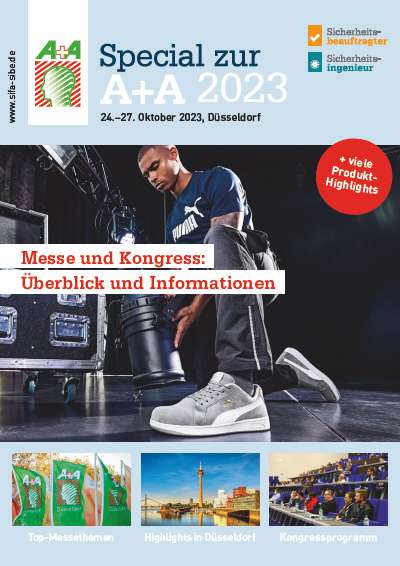Die Artikelserie begann in der vergangenen Ausgabe dieser Zeitschrift mit der Vorstellung der allgemeinen Problematik von Open Office-Bürolandschaften. Der vorliegende zweite Teil geht detailliert auf Zielkonflikte, Wechselwirkungen und einzelne Problemfaktoren ein.
Dipl.-Ing. Horst Werner
Zielkonflikte: „Open Office“ – Arbeitssicherheit
1. Ökologische Ausrichtung –
Unsere Webinar-Empfehlung
22.02.24 | 10:00 Uhr | Das Bewusstsein für die Risiken von Suchtmitteln am Arbeitsplatz wird geschärft, der Umgang mit Suchtmitteln im Betrieb wird reflektiert, sodass eine informierte Entscheidung über Maßnahmen zur Prävention von und Intervention bei Suchtmittelkonsum am Arbeitsplatz…
Teilen:












 SifaPlus-Beiträge und das große Archiv erhalten!
SifaPlus-Beiträge und das große Archiv erhalten!