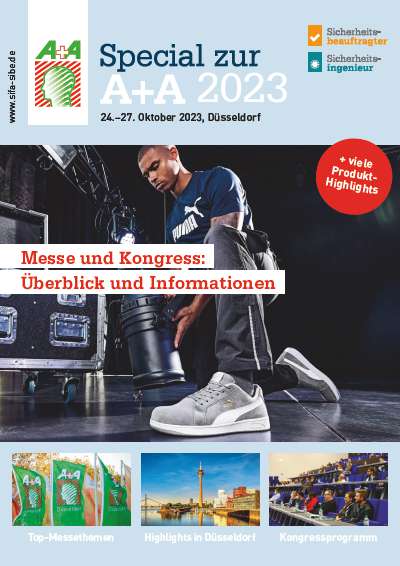Die Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV) aus dem Jahr 2013 bereitet auch den Sicherheitsingenieuren und Fachkräften für Arbeitssicherheit immer wieder Probleme. Im Rahmen der Beratung zur Gefährdungsbeurteilung, auf deren Basis die spezifische Vorsorge stattfinden soll, werden nicht nur die Betriebsärzte, sondern auch die Fachkräfte für Arbeitssicherheit mit den notwendig
Unsere Webinar-Empfehlung
Es gibt viele Fälle, in denen die Fallhöhe für eine herkömmliche Absturzsicherung nicht ausreicht. Beispiele für Arbeiten in geringer Höhe sind z.B. der Auf- und Abbau von Gerüsten, die Wartung von Industrieanlagen und Arbeiten in Verladehallen sowie Anwendungen in der Bahn und…
Teilen:










 SifaPlus-Beiträge und das große Archiv erhalten!
SifaPlus-Beiträge und das große Archiv erhalten!