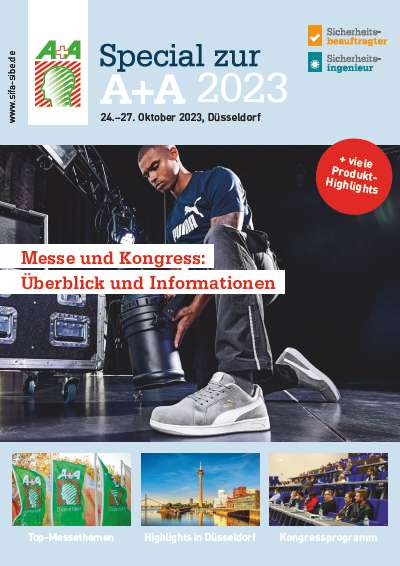Mit dem Wandel in der Arbeitswelt in Form neuer Betriebsstrukturen und Arbeitsmodelle sowie durch die rasante Weiterentwicklung und Verbreitung der digitalen Informationstechniken – vor allem dem weltweit zugänglichen und schnellen Internet – hat die Zahl der Telearbeitsplätze sowohl in Deutschland als auch weltweit erheblich zugenommen. Die Verbreitung und Nutzung
Unsere Webinar-Empfehlung
29.02.24 | 10:00 Uhr | Spielsucht, Kaufsucht, Arbeitssucht, Mediensucht – was genau verbirgt sich hinter diesen Begriffen? Wie erkennt man stoffungebundene Süchte? Welche Rolle spielt die Führungskraft bei der Erkennung, Vermeidung und Bewältigung von Suchtproblemen am Arbeitsplatz?…
Teilen:









 SifaPlus-Beiträge und das große Archiv erhalten!
SifaPlus-Beiträge und das große Archiv erhalten!