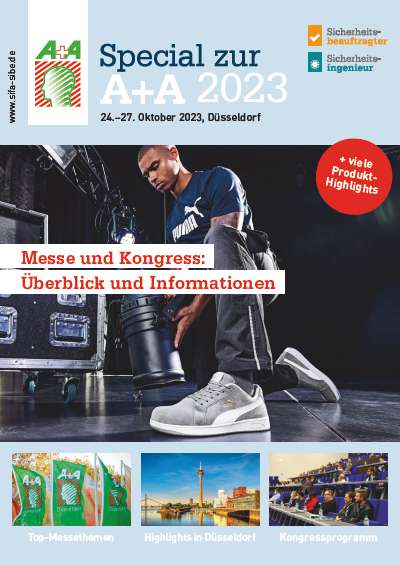Hat sich ein Unternehmen entschlossen, ein Arbeitsschutzmanagementsystem (AMS) im Betrieb einzuführen, müssen bereits im Vorfeld der eigentlichen Umsetzung viele Dinge bedacht werden. Der zweite Teil der Serie zu AMS beschreibt daher, wie sich die sogenannte Aufbauorganisation in nur fünf Schritten durchführen lässt.
Joerg Hensiek
Unsere Webinar-Empfehlung
Es gibt viele Fälle, in denen die Fallhöhe für eine herkömmliche Absturzsicherung nicht ausreicht. Beispiele für Arbeiten in geringer Höhe sind z.B. der Auf- und Abbau von Gerüsten, die Wartung von Industrieanlagen und Arbeiten in Verladehallen sowie Anwendungen in der Bahn und…
Teilen:












 SifaPlus-Beiträge und das große Archiv erhalten!
SifaPlus-Beiträge und das große Archiv erhalten!