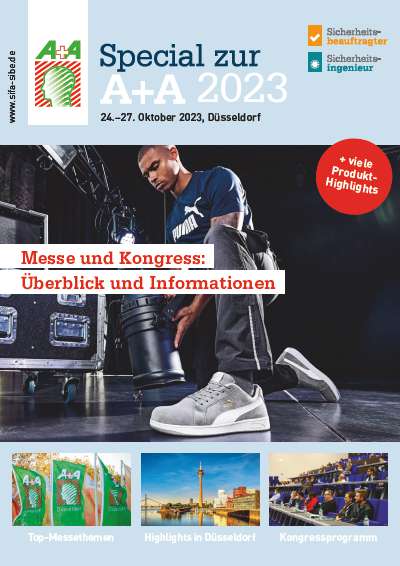Moderner betrieblicher Arbeitsschutz soll systematisch, gestaltend, vernetzt und umfassend präventiv angelegt sein. Das bringt für alle Beteiligten Herausforderungen mit sich. Arbeitsschutzfachleute können hier ihren Handlungsspielraum erweitern, indem sie Methoden aus dem systemischen Coaching aufgreifen – gerade in der Betreuung kleinerer und mittelständischer Unternehmen (KMU).
Carola Brennert
Unsere Webinar-Empfehlung
Es gibt viele Fälle, in denen die Fallhöhe für eine herkömmliche Absturzsicherung nicht ausreicht. Beispiele für Arbeiten in geringer Höhe sind z.B. der Auf- und Abbau von Gerüsten, die Wartung von Industrieanlagen und Arbeiten in Verladehallen sowie Anwendungen in der Bahn und…
Teilen:











 SifaPlus-Beiträge und das große Archiv erhalten!
SifaPlus-Beiträge und das große Archiv erhalten!