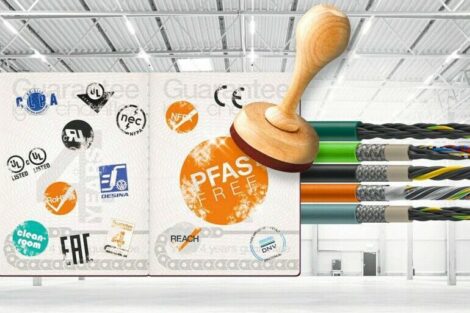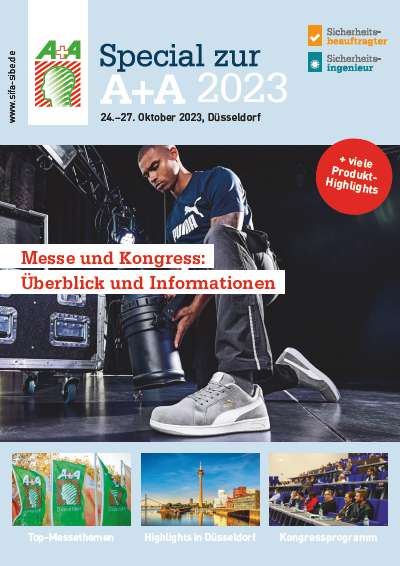Bekanntlich setzt sich der Qualifikationsstatus „Elektrofachkraft“ aus den drei Teilen fachliche Ausbildung, praktische Kenntnissen und Erfahrungen sowie der Kenntnis der einschlägigen Vorschriften, Normen und Bestimmungen zusammen. Darüber hinaus zeigt die Lebenserfahrung, dass beim Umgang mit elektrischem Strom immer etwas passieren kann. Daher ist fraglich, ob eine Elektrofachkraft auch gleichzeitig
Unsere Webinar-Empfehlung
15.06.23 | 10:00 Uhr | Maßnahmenableitung, Wirksamkeitsüberprüfung und Fortschreibung – drei elementare Bausteine in jeder Gefährdungsbeurteilung, die mit Blick auf psychische Belastung bislang weniger Beachtung finden.
Teilen:











 SifaPlus-Beiträge und das große Archiv erhalten!
SifaPlus-Beiträge und das große Archiv erhalten!