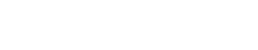Feuerwehrleute und Rettungskräfte sind die Helden in der größten Not. Dort, wo niemand sonst Hilfe leisten kann, sind Feuerwehr und Rettungsmannschaften zur Stelle und retten Menschenleben. Die Einsatzkräfte erfahren große Anerkennung für ihre Arbeit in der Bevölkerung. Solche Tätigkeiten haben jedoch auch Schattenseiten: Die physischen und psychischen Anforderungen an die Einsatzkräfte sind sehr hoch. Die Konfrontation mit lebensbedrohlichen Situationen und dem Leid anderer Menschen gehört für Feuerwehrleute und Rettungskräfte zum Berufsalltag. In jedem Einsatz erleben sie mit, wie andere Menschen, Kollegen oder sogar sie selbst extremen Belastungen ausgesetzt sind und im schlimmsten Fall ihr Leben verlieren können.
Dabei besteht die Arbeit der Feuerweh-ren heute nur noch zu einem kleineren Teil aus der originären Brandbe-kämpfung. Deutlich häufiger sind Einsätze bei schweren Unfällen, Umweltkatastrophen oder Beschädigungen durch Elementarkräfte. Befragungen von niederländischen Feuerwehrmännern zu psychischen Belastungen durch ihre Einsatztätigkeit zeigten, dass die Tätigkeit von den Befragten heute als fordernder betrachtet wird als noch vor 20 Jahren. Zurückgeführt wird dies auf das erweiterte Arbeitsfeld, das neben Brandbekämpfung heute vor allem technische Unterstützung bei Verkehrsunfällen, Rettungs- oder Reanimationsmaßnah-men, im Katastrophenschutz und bei der Beseitigung von Gefahrgut miteinbezieht. Zu weiteren Belastungsfaktoren gehören neue Gefahrenquellen am Einsatzort (wie Gifte und Krankheitserreger), vermehr-te und längere Einsätze, häufigere Übungen und höhere Trainingsanforderungen, vermehrte Protokollpflichten, mehr Verantwortung und schließlich auch ein höherer sozialer Druck.
Zu den besonders belastenden Einsätzen zählen solche, bei denen es zum Anblick von oder Kontakt mit dramatischen Verletzungen, entstellten, verstümmelten, verbrannten oder verwesenden Leichen, Wasserleichen oder Verwesungsgeruch kommt. Viele solcher Sinneserfahrungen gehören aber zu den alltäglichen Erleb-nissen von Einsatzkräften. Durch solche Eindrücke kann es auch zu sekundärem traumatischem Stress kommen. Dieser entsteht durch das Wissen um ein traumatisches Ereignis, das einer anderen Person widerfährt oder widerfahren ist – eine
Belastung, die durch das Helfen oder den Versuch zu helfen entsteht. Sekundärer traumatischer Stress wird daher als eine absehbare und natürliche Reaktion auf die Konfrontation mit den traumatischen
Erlebnissen anderer beschrieben.
Dabei gibt es mehrere Gründe für die Anfälligkeit von Helfenden für sekundären traumatischen Stress. Empathie, die Fähigkeit, sich gefühlsmäßig in einen anderen Menschen hineinzuversetzen, spielt hier eine große Rolle. Sie ist eine der wichtigsten Voraussetzungen in der professionellen Arbeit mit Traumatisierten und gleichzeitig der Schlüsselfak-tor, durch den es zu einer Traumatisierung (siehe Kasten auf dieser Seite) kommen kann: Angst, Entsetzen, Trauer und Leid eines Opfers erzeugen durch das empathische Einfühlen des Helfers eine Resonanz in diesem und werden so – in abgeschwächter Form – von ihm nachempfunden.
Von Depressionen bis Rückenschmerzen
Die Symptombelastung durch Extremsituationen ist bei Einsatzkräften insgesamt sehr hoch. Einsätze im Rahmen von Katastrophen sind mit diversen Symptomen und Störungsbildern wie Depressionen, Konzentrationsstörungen, Verwirrtheitszuständen, dissoziativen Phänomenen (z.B. Erinnerungsverlust, Bewusstseinsstörungen, Störungen der eigenen Identität) und Rückenschmerzen assoziiert. Bei den beteiligten Personen kann es außerdem zu Angststörungen aller Art, sowie Alkohol- und Drogenmissbrauch kommen. Einsatzkräfte berichten in hohem Maße über Kopf- und Rückenschmerzen, Nervosität und Reizbarkeit, Kreislaufstörungen und gastrointestinalen Beschwerden.
Besonders alarmierend ist die Häufigkeit von kardiovaskulären Erkrankungen. So konnten 45% aller Todesfälle im Einsatzgeschehen von Feuerwehrleuten und Rettungskräften auf Herzerkrankungen zurückgeführt werden und nicht etwa, wie vielleicht zu erwarten wäre, auf Verbrennungen oder Rauchvergiftungen. Neben der extremen körperlichen Belastung der Einsatzkräfte lässt sich die Häufigkeit dieser Erkrankungen auf die gesundheitlichen Auswirkung giftiger Dämpfe wie Kohlenmonoxid, Feinstaubpartikel und andere toxische Chemikalien im Rauch, sowie die Auswirkungen von psychischem und emotionalem Stress zurückführen.
Neben den Belastungen im Einsatz sehen sich Feuerwehr- und Rettungskräfte auch den gestiegenen Anforderungen im Wachalltag ausgesetzt. Die stetig zunehmende ständige Verfügbarkeit und Alarmbereitschaft übt einen nicht zu unterschätzenden Druck auf die Berufsfeuerwehrleute aus. Die Bereitschaftszeiten stellen eben nicht Erholungsphasen von belastenden Einsätzen dar, wie man möglicherweise vermuten kann. Vielmehr handelt es sich auch hier um Zeiten kontinuierlicher Einsatzbereitschaft und Anspannung der Feuerwehrleute. Hinzu kommen die alltäglichen Aufgaben in einer Feuerwehrwache, die ebenfalls erledigt werden müssen. Im Einzelnen zeigen sich folgende zentrale Stressbelastungen für Berufsfeuerwehrleute:
- Unbekannte und ständig wechselnde Situationen
- Ungewissheit vor und während Einsätzen
- Zeitdruck
- Ständige Verfügbarkeit/Einsätze zu jeder Zeit
- Physische Belastungen
- Psychische Belastungen durch trauma-tisierende Ereignisse
- Unsicherheit durch Verantwortungsdruck
- Arbeit in der Öffentlichkeit
- Infektionsrisiken
- Witterungseinflüsse
- Gefahren an der Einsatzstelle
- Besonders belastende Einsätze (z.B. Einsätze mit Kindern)
Im Gespräch mit einem Angehörigen einer Berufsfeuerwehr in einer deutschen Großstadt werden die potenziellen Gefahren und Risiken der Tätigkeit – auch und insbesondere im psychischen Bereich und den daraus sich ergebenden Gefährdungen im Hinblick auf eine posttraumatische Belastungsstörung – deutlich. Anders als sonst in dieser Serie wird nicht nur der Berufsalltag fokussiert, sondern auch auf ausgewählte Einsätze und deren Auswirkungen eingegangen. Wie immer wird über Expertenbeiträge das beschriebene Erleben kommentiert und es werden Hinweise zu Ansätzen der Prävention und Intervention bezüglich psychischer Belastungen am Arbeitsplatz gegeben.
Interview
Feuerwehrmann: „Ich mache diesen Job nun schon seit fast 20 Jahren. Ich bin mit Leib und Seele Feuerwehrmann, wollte das schon als Kind werden. Meine Arbeitszeiten sind natürlich vom Schichtdienst gekennzeichnet. Eine Schichtfolge dauert drei Wochen. In der ersten Woche ist montags ein Nachtdienst, der um 16:30 Uhr beginnt und am nächsten Morgen um sieben Uhr endet. Mit diesem Dienst beginnt eine neue Grundeinteilung, d.h. jeder Kollege hat in den nächsten drei Wochen eine bestimmte Funktion die er ausübt. Nach Dienstbeginn steht zuerst eine Fahrzeug- und Geräteübernahme an, die sehr ausführlich gemacht wird und bis zum Abend dauert. Im nächsten Nachtdienst am Mittwoch gibt es nach der Fahrzeug- und Geräteübernahme eine Aus- bzw. Fortbildungseinheit, wie in der darauffolgenden Woche auch. Ab 20 Uhr ist Bereitschaftsdienst, d.h. die Beamten können persönlichen Interessen nachgehen, dürfen aber die Feuerwache nicht verlassen, sondern müssen jederzeit sofort ausrücken können. Freitags und sonntags stehen 24-Stunden-Schichten auf dem Dienstplan, d.h. Dienstbeginn ist um sieben Uhr morgens, Dienstende um sieben Uhr am nächsten Tag. Am Sonntag stehen morgens zwei Stunden Dienstsport an, danach ist Bereitschaftszeit.
In der folgenden Woche ist dienstags und donnerstags eine Nachtschicht, in der nach der Fahrzeug- und Geräteübernahme eine Aus- bzw. Fortbildungseinheit stattfindet. Am Samstag ist wieder eine 24-Stunden-Schicht, in der vormittags Dienstsport auf dem Programm steht. Die dritte Woche wird intern als Tagdienst-Woche bezeichnet und dauert von Montag bis Donnerstag. Der Dienst beginnt um sieben Uhr morgens und dauert bis 16:30 Uhr. In dieser Zeit stehen Werkstattdienst, Dienstsport und z.T. Aus- bzw. Fortbildung auf dem Plan. Nach der Tagdienst-Woche haben die Beamten ein freies Wochenende. In diesen drei Wochen kommen so 168 Stunden Dienst zusammen, das sind im Durchschnitt 56 Stunden pro Woche. Da die wöchentliche Arbeitszeit der Berufsfeuerwehr 48 Stunden beträgt, bekommen die Kollegen immer wieder einzelne Schichten frei, um diese durchschnittliche Wochenarbeitszeit zu erreichen.“
Experte: „Wie in allen Berufen mit Schichtdienst ist auch bei der Feuerwehr die Arbeit im Schichtdienst ein psychischer Belastungsfaktor an sich. Sowohl der Arbeitgeber als auch der Mitarbeiter können einen Beitrag dazu leisten, die negativen Folgen des Schichtdienstes zu reduzieren oder gar ganz auszuschalten. Auf Seiten des Arbeitgebers sind das beispielsweise die Beteiligung der Beschäftigten bei der Schichtplangestaltung, die Erfassung des Chronotyps und dessen Berücksichtigung bei der Schichtplangestaltung, die arbeitsmedizinische Betreuung der Beschäftigten, die Durchführung von Informationsveranstaltun-gen, auf denen Beschäftigte erfahren, was sie selbst für ihre Gesundheit tun können, die Verteilung von Flyern zum Thema Schichtarbeit, je nach Größe des Betriebs auch eine Kinderbetreuung, die zugeschnitten auf die Schichtzeiten angeboten wird, das Angebot von gesunden Mahlzeiten auch nachts sowie die Einrichtung von Pausenräumen, in denen auch die Möglichkeit besteht, leichtere Mahlzeiten zu erwärmen.
Der Mitarbeiter kann sich mit den Problemen der Schichtarbeit auseinandersetzen, an arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen teilnehmen, auf gesunde Ernährung achten, ein dem Schichtdienst angepasstes Schlafverhalten bzw. eine angepasste Schlafumgebung etablieren und seine sozialen Kontakte pflegen.“
Feuerwehrmann: „Nach dem Dienstbeginn steht täglich der Fahrzeug- und Gerätecheck an: Die Besatzung eines Fahrzeuges überprüft dabei anhand von Listen, ob alle Ausrüstungsgegenstände vorhanden und funktionsfähig sind. Das dauert etwa eine Stunde. Danach folgt zum Beispiel Unterricht zu Geräten oder Einsatztaktiken und Informationen über Neuigkeiten der Branddirektion oder aus den anderen Fachbereichen der Feuerwehr (Atemschutzabteilung, Rettungsassistentenschule oder Abteilung für Gerätetechnik). Auch kleine Übungen mit Teilen der Ausrüstung werden gemacht. Arbeitsdienst in der Wache wie kleinere Reparaturen und Wartungen am Gebäude, Reinigung von Fahrzeug und Gerät, Kontrollfahrten zu Baustellen (für die Feuerwehr müssen schließlich Durchfahrts- und Zugangsmöglichkeiten bleiben) und Dienstsport füllen den Tagesablauf. Dazu zählen auch Grünarbeiten und Winterdienst rund um das Wachgebäude.
In jeder Schicht liegt irgendeine Arbeit an, da die Feuerwehr vieles selbst macht: Schlauchwäsche, Desinfektion der Rettungswagen, Wartung der Atemschutzgeräte. Abends ist dann Bereitschaftsdienst, den sich jeder gestalten kann, wie
er möchte – vorausgesetzt, er bleibt einsatzbereit. Einige Kollegen legen noch eine Extrarunde im Fitnessraum ein, andere bringen sich ihr Hobby mit, etwa ihre Gitarre oder begnügen sich mit dem
Fernsehprogramm.“
Experte: „Das Spannungsfeld zwischen unmittelbarer und permanent verlangter Einsatzbereitschaft einerseits und Phasen des ‚Bereithaltens‘ andererseits kann zur Belastung werden. Aktivitäten, die zur Erhaltung der Einsatzfähigkeit dienen, helfen dabei, auch außerhalb der Einsätze etwas Sinnvolles zu tun. Dennoch gilt es auch, mit dem geforderten ‚Alarmzustand‘ umzugehen. Das schnelle Umschalten vom ‚Stand-by‘ in den ‚Einsatzmodus‘ lässt sich trainieren. Entsprechende Angebote sollten den Einsatzkräften gemacht werden. Innere Dialoge können hier ebenso hilfreich sein wie kognitive Programmierungen, bei denen durch das Wiederholen von Selbstinstruktionen Bewusstseinszustände gezielt herbeigeführt und geschärft werden können.“
Feuerwehrmann: „Wenn das Einsatzsignal ertönt, muss es schnell gehen. Die notwendigen Schritte und Abläufe werden immer wieder geübt und trainiert. Dennoch ist es jedes Mal eine besondere Situation, wenn wir mit dem Einsatzfahrzeug die Wache verlassen. Auf dem Weg zum Einsatzort erhalten wir nähere Informationen dazu, was uns erwartet. Die meisten Einsätze liegen im Bereich „Rettungsdienst“. Mit dem Rettungswagen wird man sehr oft für internistische Notfälle gerufen, zum Beispiel Atemnot oder Herzprobleme. Nur etwa ein Drittel sind sogenannte chirurgische Notfälle, also der klassische Haus- oder Verkehrsunfall.
Im klassischen Feuerwehrbereich werden wir oft zu kleineren Einsätzen gerufen: Ölspuren auf den Straßen beseitigen, Türöffnungen, wenn ein Patient die Wohnung nicht mehr selbst für den Rettungsdienst öffnen kann, Kleinbrände von zum Beispiel Abfalltonnen und Kochtöpfen. Viele Einsätze sind leider auch Fehlalarme durch automatische Brandmeldeanlagen. Die Einsätze, die man schließlich in der Zeitung wiederfindet, wie schwere Verkehrsunfälle mit Eingeklemmten oder Großbrände, sind glücklicherweise nicht das hauptsächliche Tagesgeschäft.“
Experte: „Glücklicherweise sind viele Einsätze der Feuerwehr eher ‚harmloserer‘ Natur. Besonders belastende Ereignisse sind lebensbedrohliche Einsätze, Verletzungen der körperlichen Unversehrtheit, der Tod eines Kollegen, der Tod von Kindern, Großschadenslagen, Situationen extremer Handlungsunfähigkeit, bizarre Selbstmorde und Einsätze mit extremen Sinneserfahrungen, z.B. durch schreiende, stöhnende oder weinende Opfer. Daneben wirken sich aber auch die Rahmenbedingungen der Einsätze belastend aus: lange Wartezeiten bis zum Einsatz, mangelhafte Informationen und unklare Einsatzmeldungen, ein unvor-hersehbares Einsatzgeschehen, das Handeln unter Zeit- und Ereignisdruck am Einsatzort sowie generell die 24-Stunden-Bereitschaften und Nachtschichten.
Zusätzliche Belastungen durch den Einsatz ergeben sich bei persönlicher unmittelbarer Betroffenheit, durch das Ausmaß an Verantwortung (z.B. bei Führungsaufgaben durch den Dienstgrad), das Vorhandensein negativer Bewertungen eines Einsatzes sowie bei Selbstvorwürfen, wenn man weiß oder glaubt, dass etwas falsch gelaufen ist.“
Feuerwehrmann: „Wenn der Einsatz läuft, versucht man soweit wie möglich auf Routinen und eingespielte Abläufe zurückzugreifen. Das ist nicht einfach, denn jede Einsatzsituation ist anders. Es kommt sehr auf das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, aber auch in die der Kollegen an. Wir müssen als Team funktionieren. Das was man erlebt und sieht, versucht man zunächst einmal gar nicht an sich herankommen zu lassen. Umso wichtiger ist es, dass man nach einem Einsatz Möglichkeiten hat, das Geschehene zu verarbeiten. Und das nicht nur im Sinne einer professionellen Analyse – Was hätten wir anders/besser machen können/müssen? Was funktionierte gut? –, sondern auch und gerade im Hinblick auf die eigenen Gefühle und Erlebnisse während des Einsatzes.“
Experte: „Nach wie vor besteht in den ‚helfenden Berufen‘ die Gefahr, dass eine eigene Hilfsbedürftigkeit nicht eingestanden wird. Helfer neigen dazu, zu lang im Einsatz zu bleiben und dabei ihre eigenen Stressreaktionen zu übersehen. Sie neigen dazu, sich in ihren Hilfestellungen weit über psychische und körperliche Grenzen hinaus zu verausgaben oder versuchen im Anschluss an eine Katastrophe ohne fremde Hilfe zurechtzukommen. Eigene Verletzbarkeit wird geleugnet oder verdrängt. Das überwiegend männliche Einsatz- und Rettungspersonal hat nach berufsbedingten Traumata oftmals Schwierigkeiten, psychotherapeutische Hilfsangebote anzunehmen.
(Zu) viele leben immer noch mit dem Selbstideal eines Mannes, den nichts erschüttern kann und lehnen das Sprechen über Gefühle als „unmännlich“ ab. Sie haben die Vorstellung, traumatische Erfahrungen müssten an einem echten Mann „abprallen“. Hinzu kommt die Idee, immer handlungsfähig sein und allzeit die Kontrolle aufrechterhalten zu müssen. Ist das nicht möglich, führt das zu einer akuten Diskrepanz zwischen Ideal- und eigenem Selbstbild. Gerade für solche Einsatzkräfte sind schwere Verläufe von posttraumatischen Belastungen zu erwarten, da die damit verbundenen Symptome von Schwäche und Hilflosigkeit nicht mit dem eigenen Selbstbild vereinbar erscheinen. Meist nehmen diese Einsatzkräfte erst dann fachliche Hilfe in Anspruch, wenn sich ihre Problematik nicht mehr länger leugnen lässt, z.B. weil sie durch Schlaf- oder Funktionsstörungen, unkonzentriertes oder unkorrektes Verhalten am Arbeitsplatz auffällig werden. Häufig erfolgt auf das Eingestehen der Schwäche eine völlige Dekompensation. Zudem besteht für diese Einsatzkräfte eine erhöhte Suchtgefahr – insbesondere in Bezug auf Alkohol – sowie eine erhöhte Suizidgefährdung.“
Feuerwehrmann: „Zum Glück bekommen wir inzwischen auch nach den Einsätzen – speziell nach Großeinsätzen – Unterstützung von Notfallseelsorgern oder Psychologen. Ich habe das anfänglich für übertrieben erachtet. Andererseits
habe ich im Laufe meiner beruflichen Karriere auch Kollegen erlebt, die an den Eindrücken eines Einsatzes kaputt gegangen sind.“
Experte: „Das Ziel der frühzeitigen Intervention in der peritraumatischen Phase – d.h. in den ersten Stunden nach einem traumatischen Ereignis – besteht darin, die Betroffenen zu unterstützen, das Erlebnis ohne schwere gesundheit-liche Folgestörungen zu überstehen und erste Schritte in Richtung Verarbeitung einzuschlagen. Zunächst einmal müssen nach dem Einsatz basale Bedürfnisse wie Essen, Trinken, sich waschen, die Einsatzkleidung ablegen etc. befriedigt werden. Darüber hinaus sind die Weitergabe von Informationen, die Milderung physiologischer Reaktionen und weiterführende psychosoziale Unterstützung primäre Ziele der Intervention. Ein wichtiger Aspekt dabei ist, den Betroffenen zu helfen, die posttraumatische Reaktion zu verstehen. Dazu gehört, ihnen begreiflich zu machen, dass die ungewohnten Empfindungen, die sie bei sich wahrnehmen, normale Reaktionen auf das Ereignis darstellen.
Mit der verstärkten Erforschung der psychischen Belastung speziell bei Einsatzkräften wurde auch der Bedarf an einsatzspezifischen Präventionsmaßnahmen deutlich. Die Unterteilung des Präventionsbegriffs in die Bereiche Primäre, Sekundäre und Tertiäre Prävention erweist sich dabei als hilfreiche Gliederung.
Unter Primärer Prävention wird das Eingreifen vor Auftreten eines belastenden Einsatzes verstanden, im Sinne einer Vorsorgemaßnahme. Sekundäre Prävention beschreibt das Eingreifen zeitlich nach dem Auftauchen erster Symptome, mit dem Ziel, eine Chro-nifizierung zu verhindern. Tertiäre Prävention kennzeichnet das Eingreifen in einem Stadium, in dem eine Störung bereits stark ausgeprägt ist, mit dem Ziel, vorhandene Symptome zu mildern.
Es scheint, dass die Durchführung von Interventionen nach belastenden Einsätzen prinzipiell sinnvoll sein kann. Dies lässt sich jedoch nicht generalisieren und hängt von verschiedenen Einflussfaktoren ab.“
Feuerwehrmann: „Früher gab es so etwas wie ein Debriefing ja gar nicht. Da saß man nach dem Einsatz zusammen und trank ein Bier. Der eine erzählte mehr, der andere weniger. Manche tranken auch mehr als nur ein Bier. Es kam auch immer
darauf an, wer den Einsatz geleitet hatte und wie derjenige mit seinen Leuten sprach. Manchmal passierte gar nichts. Als dann das Debriefing aufkam, wurde es zum Teil auch übertrieben. Dieses emotionale Nachempfinden der Situation in einem Einsatz war und ist nicht jedermanns Sache. Deswegen ist es auch gut, wenn es Debriefings gibt, die sich nicht mit der emotionalen Aktivierung aufhalten – wo man also nicht nochmals das Erlebte gefühlsmäßig hochkommen lässt. Es ist aber nicht immer leicht zu sagen, ob die eine oder die andere Methode besser ist. Das muss ein Stück weit auch jeder für sich selbst entscheiden.“
Experte: „Die Nachbearbeitung eines Einsatzes läuft in der Regel in mehreren Phasen ab: Noch am oder in der Nähe des Einsatzortes wird ein Einsatzabschluss, die sogenannte Demobilization, durchgeführt. Das Einsatzgeschehen wird nochmals zusammengefasst, es werden Hinweise auf möglicherweise nach dem Einsatz auftretende psychische oder physische Reaktionen bei den Helfern gegeben. Die Demobilization kann auch mit größeren Gruppen durchgeführt werden. Sie hat vor allem informativen Charakter und stellt den offiziellen Schluss des Einsatzes dar. Alternativ hierzu gibt es die Kurzbesprechung, die einige Stunden nach Ende des Einsatzes, zum Beispiel am Ende einer Dienstschicht, mit einer kleineren Zahl von Teilnehmern durch-geführt werden kann und in der mehr Raum für individuelle Interaktion ist.
Nach einigen Tagen sollte bei gegebener Indikation eine Nachbesprechung – das sogenannte Debriefing – in einem geschützten Rahmen erfolgen, in dem die Einsatzkräfte ihre subjektiven Eindrü-cke, Erfahrungen und Gefühle ansprechen können. Hier kommen idealerweise sowohl psychosoziale Fachkräfte wie Seelsorger, Sozialpädagogen oder Psychologen als auch speziell geschulte Einsatzkräfte zum Zuge. Im Debriefing geht es letztlich darum, sich seiner Gefühle bewusst zu werden, diese zuzulassen, sich mit der Gruppe auszutauschen, die Normalität der eigenen körperlichen und psychischen Reaktionen nach einem Einsatz anzuerkennen und Techniken zur Stressbewältigung anzuwenden.“
Das Bewusstsein für den Umgang mit Belastungen bei Einsatzkräften ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen. In Deutschland wurden bei Großschadensereignissen, wie etwa dem ICE-Unglück in Eschede 1998 oder dem Grubenunglück bei Borken 1988, bei dem 51 Bergleute tödlich verunglückten, gezielt auch die Helfer in das Hilfs- und Präventionsprogramm nach der Katastrophe mit einbezogen und professionell langfristig betreut. Dabei erfolgte auch hier die nachträgliche Betreuung in der Regel durch speziell geschulte Teams in Form eines Debriefings. Ziel dieser Präventionsmaßnahmen war es, eine Chronifizierung erster Symptome zu verhindern. Den Schwerpunkt bei Debriefings bilden in der Regel nach wie vor eher technisch geprägte Einsatznachbesprechungen. Dennoch sollen diese Besprechungen vor allem der Entwicklung von akuten Stressreaktionen und posttraumatischer Symptomatik nach potenziell belastenden Ereignissen vorbeugen. Das Ausdrücken von Emotionen und der gemeinsame Austausch in der Gruppe mit anderen Betroffenen stellt eine wichtige Komponente für die Verarbeitung des Erlebten dar.
Unter primärer Prävention wird dagegen das Trainieren, Schulen und Besprechen bereits vor Auftreten eines belastenden Einsatzes verstanden, ganz im Sinne einer Vorsorgemaßnahme. Das grundlegende Ziel liegt darin, spezifisches Wissen und spezifische Fähigkeiten zur Traumavermeidung oder zumindest ‑abschwächung an mögliche Risikogruppen zu vermitteln, vorhandene Ressourcen zu stärken und Hilfsnetzwerke zu installieren. Angeboten werden vor allem Seminare. Zum Teil sind diese Maßnahmen offene Angebote, zum Teil sind sie obligatorischer Bestandteil der Ausbildung. Die Thematik stellt aber meist noch keinen regulären Bestandteil der offiziellen Ausbildungspläne dar, eine Integration in die Ausbildung beruht also auf der Initiative der Verantwortlichen vor Ort.
Eine der umfassendsten Untersuchungen zum Thema Prävention im Einsatzwesen – durchgeführt in den Jahren 2007 und 2008 von der Ludwig-Maximilians-Universität München – kommt zu folgenden Schlussfolgerungen: Einsatzkräfte sind durch ihre Einsatztätigkeit belastet und benötigen Begleitung, insbesondere nach außergewöhnlich belastenden Ereignissen. Diese Begleitung sollte langfristig stattfinden, nachhaltig sein, möglichst alle Betroffenen erreichen und vor einem Hintergrund von regelmäßigen primärpräventiven Veranstaltungen stattfinden. Dabei sollten Nachsorgemaßnahmen an einer kognitiven Struktur orientiert sein und gezielte emotionale Aktivierung vermeiden. Die Thematik „einsatzbedingte Belastung“ sollte Eingang in die Aus- und Weiterbildung aller Einsatzkräfte finden und im Bewusstsein als eine Gefahr an der Einsatzstelle verankert werden, so dass ein selbstverständlicher Umgang mit psychischer Belastung möglich ist.
Zur Reduktion oder gar gänzlichen Vermeidung von posttraumatischen Belastungsreaktionen werden folgende Empfehlungen gegeben:
Feuerwehren und Rettungsunter-nehmen sollten in ihrer Verantwortung als Arbeitgeber/Dienstherr eigene Präventionsstrukturen aufbauen. Voraussetzung hierfür ist die Einrichtung eines organisationsinternen Fachbereiches sowie die Bereitstellung entsprechender Planstellen.
Maßnahmen der primären und sekundären Prävention sollten unter Einbindung bereits tätiger Präventionsmitarbeiter entwickelt, aufeinander abgestimmt und umgesetzt werden.
Eine flächendeckende Durchführung strukturierter präventiver Schulungen durch kontinuierliche Ausbildung von Multiplikatoren (Peers, Seelsorger im Einsatzwesen, Fachberater Seelsorge) sollte stattfinden.
Multiplikatoren sollten Mitglied der jeweiligen Organisation oder fest in die Strukturen eingebunden sein. Die Einbindung psychosozialer Fachkräfte ist zu empfehlen.
Erforderlich ist die Anbindung der Präventionsmitarbeiter in definierte Strukturen mit fachlicher Leitung, Supervision, Weiterbildungsangeboten und Maßnahmen zur Qualitätssicherung.
Spezifische Führungskräfteschulungen im Rahmen primärer und sekundärer Prävention sind durchzuführen.
Die Bereitstellung von spezifischen Präventionsangeboten für besonders belastete Wehren ist sicherzustellen, dies auch durch verbesserten Informationsfluss zwischen Multiplikatoren und Führungspersonal.
Weitere Unterstützungsangebote für belastete Einsatzkräfte nach erfolgter „klassischer“ Nachsorge sollten vorgehalten werden, die eher als Brücke zu weiterführenden Angeboten zu de-finieren ist.
Die Durchführung von mindestens einmal jährlich stattfindenden psychosozialen „Übungen“ – analog zu technischen Übungen –, die im Sinne eines Jahresrückblicks auf die Thematik eingehen.
Schließlich sollte eine klare Differenzierung der Zielgruppen erfolgen, Einsatzkräfte sollten nicht durch Personen betreut werden, die beim gleichen Einsatz direkt Betroffene und/oder Angehörige betreut haben.
Die Angebotsdichte solcher Maßnahmen, wie die in den zehn genannten Punkten umschriebenen, ist in Deutschland zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch eher gering. Die Herausforderung der Zukunft wird daher in einer kontinuierlichen Weiterführung und dem Ausbau von psychologischer Betreuung liegen, insbesondere im Bereich der primären und der sekundären Prävention, um die psychische Gesundheit der Feuerwehrleute und Rettungskräfte zu erhalten.
Lesen Sie auch :
- Psychische Belastungen am Arbeitsplatz Teil 1 — Analyse der psychischen Belastungen in der Binnenschifffahrt generell – und bei der Bewältigung von Brückenpassagen speziell
- Psychische Belastungen am Arbeitsplatz Teil 2 — Über den Wolken … gibt es auch Stress
- Psychische Belastungen am Arbeitsplatz Teil 3 — Der Blinddarm von Zimmer 3
- Psychische Belastungen am Arbeitsplatz Teil 4 — „Herzlich Willkommen im Grandhotel Plaza“
- Psychische Belastungen am Arbeitsplatz Teil 6 — Und er läuft und läuft und läuft – Psychische Belastungen in der Automobilproduktion
Unsere Webinar-Empfehlung
15.06.23 | 10:00 Uhr | Maßnahmenableitung, Wirksamkeitsüberprüfung und Fortschreibung – drei elementare Bausteine in jeder Gefährdungsbeurteilung, die mit Blick auf psychische Belastung bislang weniger Beachtung finden.
Teilen: