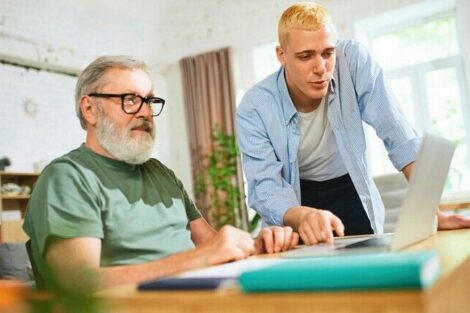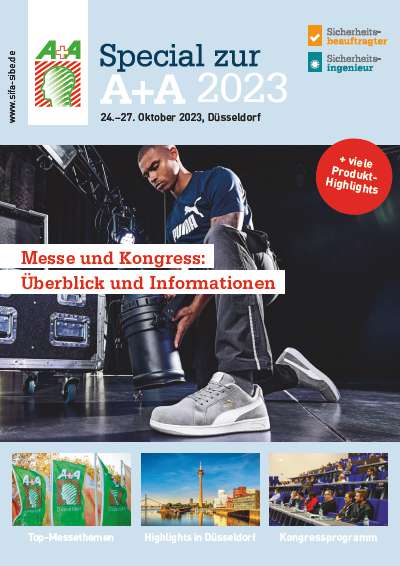Im 13. Jahr der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) trat am 1. Juni 2015 eine grundlegende Neufassung in Kraft. Die BetrSichV ist das „Grundgesetz für den technischen Arbeitsschutz“. Sie gilt für jeden Arbeitgeber, der Beschäftigte Arbeitsmittel verwenden lässt. Der Arbeitgeber hat die (Organisations-) Pflicht. Doch wer genau ist verantwortlich?
Unsere Webinar-Empfehlung
Es gibt viele Fälle, in denen die Fallhöhe für eine herkömmliche Absturzsicherung nicht ausreicht. Beispiele für Arbeiten in geringer Höhe sind z.B. der Auf- und Abbau von Gerüsten, die Wartung von Industrieanlagen und Arbeiten in Verladehallen sowie Anwendungen in der Bahn und…
Teilen:













 SifaPlus-Beiträge und das große Archiv erhalten!
SifaPlus-Beiträge und das große Archiv erhalten!