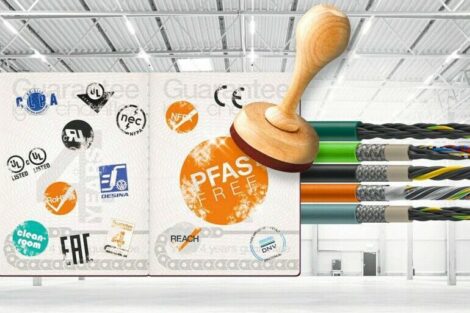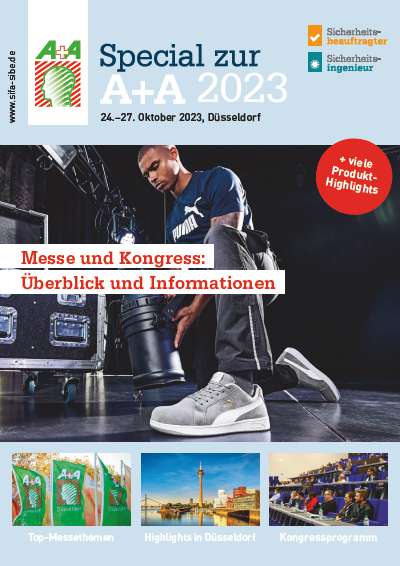Die Einführung von Arbeitsschutzmanagementsystemen (AMS) in Unternehmen ist keine gesetzliche Verpflichtung. Dennoch nimmt ihre Bedeutung in der Unternehmenslandschaft stetig zu. Grund genug, um in einer Artikelreihe die wichtigsten Aspekte der AMS vorzustellen. In dieser ersten Folge geht es um die Grundlagen: Was sind die Komponenten eines AMS, welche Auswirkungen
Unsere Webinar-Empfehlung
29.02.24 | 10:00 Uhr | Spielsucht, Kaufsucht, Arbeitssucht, Mediensucht – was genau verbirgt sich hinter diesen Begriffen? Wie erkennt man stoffungebundene Süchte? Welche Rolle spielt die Führungskraft bei der Erkennung, Vermeidung und Bewältigung von Suchtproblemen am Arbeitsplatz?…
Teilen:













 SifaPlus-Beiträge und das große Archiv erhalten!
SifaPlus-Beiträge und das große Archiv erhalten!