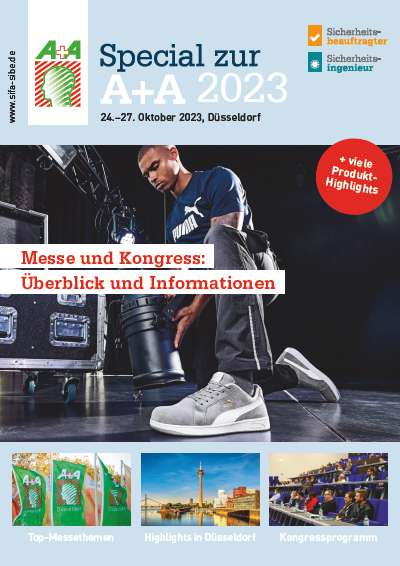Lärm gehört zu den häufigsten Gesundheitsgefährdungen in Deutschlands Betrieben. Ein gutes Lärmschutzmanagement ist deshalb unerlässlich. Unser Autor erklärt einige Grundlagen zum Thema Lärm, von Schallwellen bis zur Messung in Dezibel, und welche Regelwerke für den Lärmschutz im Betrieb wichtig sind.
Dr. Joerg Hensiek
Lärmschwerhörigkeit
Unsere Webinar-Empfehlung
22.02.24 | 10:00 Uhr | Das Bewusstsein für die Risiken von Suchtmitteln am Arbeitsplatz wird geschärft, der Umgang mit Suchtmitteln im Betrieb wird reflektiert, sodass eine informierte Entscheidung über Maßnahmen zur Prävention von und Intervention bei Suchtmittelkonsum am Arbeitsplatz…
Teilen:











 SibePlus-Beiträge und das große Archiv erhalten!
SibePlus-Beiträge und das große Archiv erhalten!