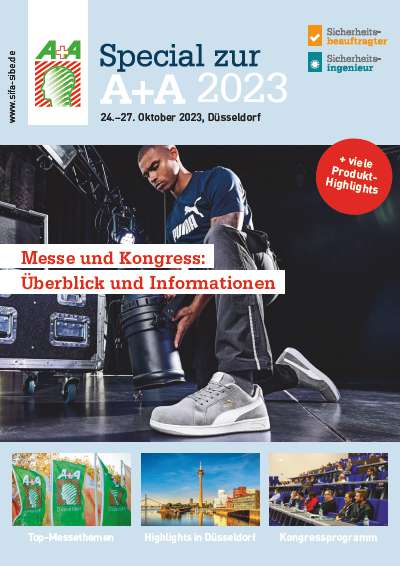In vielen Betrieben ist die Einhaltung gesetzlicher Standards selbstverständlich. Werden Gefährdungsbeurteilung, Unterweisungen und Sicherheitsregeln durchgeführt bzw. erstellt, gelten die wesentlichen gesetzlichen Bestimmungen als erfüllt. Bei vielen Beteiligten führt das oft zu der beruhigenden Gewissheit, dass nun alles getan wurde, um sichere und gesunde Arbeitsbedingungen herzustellen. Jedoch zeigt sich in
Unsere Webinar-Empfehlung
15.06.23 | 10:00 Uhr | Maßnahmenableitung, Wirksamkeitsüberprüfung und Fortschreibung – drei elementare Bausteine in jeder Gefährdungsbeurteilung, die mit Blick auf psychische Belastung bislang weniger Beachtung finden.
Teilen:











 SifaPlus-Beiträge und das große Archiv erhalten!
SifaPlus-Beiträge und das große Archiv erhalten!