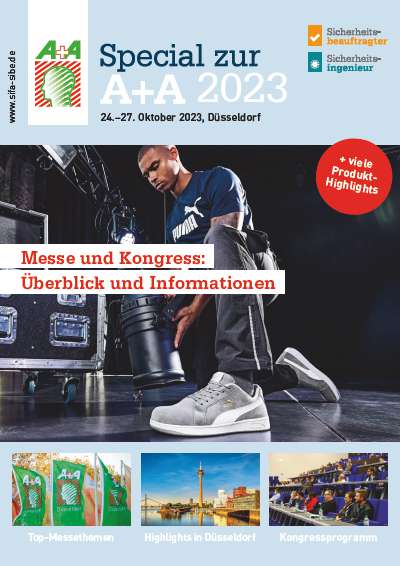Allgemein regelt den Umgang mit fahrbaren Hubarbeitsbühnen die Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) unter Berücksichtigung der Technischen Regeln für Betriebssicherheit (TRBS) sowie der DGUV Grundsatz 308–008. Die DGUV Information 208–019 gibt detaillierte Informationen zur Verwendung von Persönlicher Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA). Ein Teil der oft zu sehenden Variantenvielfalt an Sicherungsmaßnahmen liegt sicher auch an den sich über die Jahre immer wieder ändernden Empfehlungen. Aber mittlerweile gibt es klare Regeln.
Um diese praxisgerecht umzusetzen, betrachten wir das Absturzrisiko beim Arbeiten mit mobilen Hubarbeitsbühnen im Detail und ganzheitlich. Besonders möchte ich auf typische Fragen eingehen, die mir immer wieder vor Ort gestellt werden.
In welchen Bühnen muss ich mich sichern?
Grundsätzlich lassen sich fahrbare Arbeitsbühnen in zwei Klassen einteilen: Klasse A umfasst Teleskop und Scherenhubbühnen (der Schwerpunkt der Bühne bleibt auch beim Ausfahren immer innerhalb der Kippkante) und Klasse B umfasst alle anderen Bühnentypen wie z. B. Ausleger- oder Gelenkarbeitsbühnen. Weiter werden diese zwei Klassen in je drei Typen unterteilt: Bei Typ 1 ist das Fahren nur in Transportstellung zulässig, bei Typ 2 wird das Fahren mit angehobener Arbeitsbühne nur von einer Steuerstelle am Untergestell aus erlaubt und bei Typ 3 wird das Fahren mit angehobener Arbeitsbühne von der Bedienstelle auf der Arbeitsbühne gesteuert. Diese Differenzierung berücksichtigt, dass nicht bei allen Bühnentypen das gleiche Absturzrisiko besteht.
Peitschen- oder Katapulteffekt
Der besonders gefährliche Peitschen- oder Katapulteffekt tritt vor allem bei Teleskop (Ausleger-) Arbeitsbühnen auf (Klasse B), wenn diese von einer Bedienstelle auf der Arbeitsbühne gesteuert werden. Bedenken Sie aber auch andere Risiken wie z. B. Versetztfahrten (Fahrten mit angehobener Arbeitsbühne), das Anfahren oder Anprallen an eine Störkante oder das Verhaken der Bühne mit der Arbeitsumgebung.
Das Tragen einer PSAgA in Hubarbeitsbühnen ist vorgeschrieben, wenn die Gefährdungsbeurteilung (z. B. Peitscheneffekt) und/oder die Betriebsanleitung des Hubarbeitsbühnenherstellers dies als notwendige Maßnahme vorgibt oder der Bauherr auf seiner Baustelle die Benutzung der PSAgA festlegt.
Auf Senkrechtliften (Klasse A), z. B. Scherenbühnen, ist PSAgA in der Regel nicht erforderlich – es sei denn, dass besondere Einsatzbedingungen (Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung) oder Angaben des Herstellers (Betriebsanleitung) dies erfordern (siehe DGUV Information 208–019). Hier stellt sich jedoch die Frage, ob Bediener die Risikobewertung kennen und/oder befolgen. Eine generelle Sicherungspflicht schafft klare Verhältnisse.
Häufigkeit von Unfällen mit Todesfolge
In den vergangenen Jahren wurden in Deutschland durchschnittlich fünf tödliche Unfälle beim Bedienen von Hubarbeitsbühnen gemeldet. Im globalen Gesamtbild berichtet die IPAF (International Powered Access Federation) von 93 gemeldeten tödlichen Abstürzen von Hubarbeitsbühnen im Zeitraum 2019 bis 2020 und stellt fest, dass Stürze aus der Höhe die häufigste tödliche Unfallursache beim Arbeiten mit Hubarbeitsbühnen darstellen (siehe IPAF globaler Sicherheitsbericht MEWP 2020).
Welche Ausrüstung zur Absturzsicherung ist zu verwenden?
Da PSAgA immer aus mehreren Komponenten besteht (Auffanggurt – Verbindungsmittel – Anschlagpunkt) ist es wichtig, diese Frage auf die einzelnen Komponenten aufzusplitten.
Welcher Auffanggurt ist richtig?
Grundbedingung ist die Verwendung eines Auffanggurtes geprüft nach EN 361. Ein Haltegurt (EN 358) ist nicht zulässig. Bei Tätigkeiten auf mobilen Hubarbeitsbühnen ist die Verwendung eines 2‑Punkt-Auffanggurtes (sternale und dorsale Auffangösen) wichtig (Abb. 1). So ist man unabhängig von der Position des oder der Anschlagpunkte in der Bühne und kann auch seine Arbeitsposition frei nach den Erfordernissen ausrichten.
1‑Punkt Auffanggurte schränken hier stark ein und Mehrpunktauffanggurte (mit integriertem Haltegurt) führen manchmal dazu, dass sich Anwender einfach an den seitlichen Halteösen sichern, was tödliche Gefahren birgt. Leider sind hier auch manche Piktogramme an den Arbeitsbühnen missverständlich (Abb. 2).
Welches Verbindungsmittel ist geeignet?
Das geeignete Verbindungsmittel unterliegt folgenden Anforderungen: Es muss eine Systemlänge von max. 1,8 m aufweisen, längenverstellbar sowie energieabsorbierend sein und auf Kantenbeanspruchung mit einer Umlenkung von 180°getestet und zugelassen sein. Die Restkraft auf den Anschlagpunkt darf nur 3 kN betragen (nicht die üblichen 6 kN) und in Deutschland muss dieses Verbindungsmittel auch nach DIN 19427 zertifiziert sein.
Der Markt bietet hierfür drei unterschiedliche Typen an Verbindungsmittel: Ein längenverstellbares Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer (EN 354/355), ein mitlaufendes Auffanggerät an beweglicher Führung (EN 353–2) und (Mini-)Höhensicherungsgeräte (EN 360), jeweils in der geforderten Gesamtlänge von 1,8 m.
Die ersten zwei Varianten sind besonders preisaggressiv, haben aber einen entscheidenden Nachteil: Da die Längenverstellung hier manuell erfolgen muss und keine automatische Rückstellfunktion (Einzug) vorhanden ist, stellt sich die Frage des vorhersehbaren Missbrauchs. Der immense Vorteil eines Höhensicherungsgerätes (siehe Abb. 3), das immer nur die gerade benötigte Auszuglänge ausgibt, sodass niemals ein Schlaffseil entsteht, entfällt. Die Frage, ob nicht die Mehrzahl der Anwender einen in der Länge verstellbaren Bandfalldämpfer oder ein mitlaufendes Auffanggerät einfach immer auf die längste Einstellung setzen und damit einen Großteil der Anwendungszeit mit Schlaffseil arbeiten und im Ernstfall aus der Bühne herausgeschleudert werden, darf sich jeder Leser gerne selbst beantworten. Die Verwendung eines für die Hubarbeitsbühne zugelassenen Mini-Höhensicherungsgerätes zeigt unter diesem Aspekt die größte mögliche Anwendungssicherheit.
Wo darf ich mich anschlagen?
Auf keinen Fall am Handlauf der Bühne. In neueren Bühnentypen ist ein Anschlagpunkt ausgewiesen und i.d.R. auch als solcher gekennzeichnet. Leider ist an vielen Anschlagpunkten in der Bühne nicht gekennzeichnet (Abbildungen 4 bis 8), ob es sich tatsächlich um einen Auffangpunkt nach EN 795 handelt oder (nur) um einen Haltepunkt (Abb. 9) nach EN 280 (Fahrbare Hubarbeitsbühnen). Auch die Bedienungsanleitung der Hubarbeitsbühne definiert das nicht immer. Deshalb ist es wichtig, immer ein für die Hubarbeitsbühne zugelassenes Verbindungsmittel mit einer Restkraft von weniger als 3 kN nach einem Absturz auf den Anschlagpunkt zu verwenden. Somit ist sichergestellt, dass auch ein Haltepunkt in der Arbeitsbühne sicher verwendet werden kann. Falls an Ihrer Bühne keine Anschlagpunkt zu erkennen ist und auch die Bedienungsanleitung der Bühne keine Information dazu bereithält, können Sie den Bühnenhersteller befragen. Eine fehlende Klärungsmöglichkeit führt konsequenterweise zur Stilllegung der Arbeitsbühne. Achten Sie auch auf eine sinnvolle Karabinerkombination Ihres Verbindungsmittels. Eine Ausführung mit Gerüsthaken passt meist nicht in die an der Arbeitsbühne vorgesehenen Anschlagpunkte und verleitet generell zum Anschlagen am Geländer.
Wie hoch ist das maximale Anwendergewicht?
EN Normen prüfen grundsätzlich mit einer Prüfmasse von 100 kg. Dies erscheint auch unter dem Aspekt, dass Anwender zusätzliche Ausrüstung mit sich führen, zu gering. Deshalb lassen verschiedene Hersteller von PSAgA ihre Ausrüstung auch für höhere Anwendergewichte testen und zertifizieren. Üblich ist hier ein erhöhtes Prüfgewicht von 140 kg. Achten Sie beim Kauf darauf! Bedenken Sie auch, dass ein Verbindungsmittel auch ein minimales Anwendergewicht (meist um die 60 kg) fordert, um zu funktionieren.
Ab welcher Höhe muss ich mich sichern?
Wenn die Gefährdungsbeurteilung oder Vorgaben die Sicherung mit PSAgA erfordern, ist diese immer vorzunehmen. Die Angabe der Mindestarbeitshöhe des Verbindungsmittel (je nach Hersteller 4 bis 5 m) scheint hier auf den ersten Blick widersprüchlich, aber ist sie es tatsächlich?
Leider gehen auch in Katalogen von Herstellern und in Publikationen die Begriffe manchmal etwas durcheinander. Deshalb hier zuerst die Definitionen:
- Fallstrecke – ist die Strecke, die der Anwender bei einem Absturz fällt. Sie wird durch die Länge des Verbindungsmittels bestimmt (durch den definierten Anschlagpunkt in der Arbeitsbühne kann diese Strecke nicht durch eine Änderung des Fallfaktors beeinflusst werden).
- Bremstrecke – diese benötigt das Verbindungsmittel zur Verringerung der Aufprallenergie. Die Fall- und diese Bremsstrecke addiert sich zur Auffangstrecke. Geben wir zur Auffangstrecke noch 1 m Sicherheitszuschlag haben wir die Mindestarbeitshöhe.
Zur Beantwortung der Widersprüchlichkeit ist es darüber hinaus wichtig, das Prüfschema der DIN 19427 zu kennen. Während grundsätzlich die Mindestarbeitshöhe eines Verbindungsmittel von der Standfläche des Benutzers aus berechnet wird, gibt die DIN 19427 ein anderes Berechnungsschema vor. Dabei wird die Mindestarbeitshöhe nicht von der Standfläche in der Hubarbeitsbühne gemessen, sondern von der Oberkante des Handlaufs, also 1,10 m darüber. Dabei befindet sich der Anschlagpunkt max. 0,75 m über der Standfläche (Geländerhöhe 1,10 m minus Abstand des Anschlagpunktes von 0,35 m unterhalb des Handlaufs). Dazu ein praktisches Beispiel: Die Mindestarbeitshöhe des für Hubarbeitsbühnen zugelassenen Verbindungsmittels ist mit 5 m angeben. Das bedeutet ab einer Standhöhe von 3,9 m der Bühnenplattform hält der Anwender bereits die Mindestarbeitshöhe ein. Diese beinhaltet einen Sicherheitszuschlag von 1 m, ist hier mit einer Anwendergröße von 2 m kalkuliert und unter Annahme der ungünstigsten Situation gerechnet.
Dazu kommt, dass die PSAgA in den meisten Fällen das Herausschleudern aus der Hubarbeitsbühne komplett verhindert und den Anwender in der Arbeitsbühne hält. Eine Gefährdungsbeurteilung kommt folgerichtig zu dem Schluss, dass das Arbeiten mit angelegter PSAgA in der Hubarbeitsbühne bei jeder Arbeitshöhe sicherer ist als ohne.
Darf ich mit PSAgA aus der Bühne außerhalb der Grundstellung aussteigen?
Grundsätzlich ist der Ein- und Ausstieg aus der Hubarbeitsbühne nur in Grundstellung erlaubt. Wenn der Ein- oder Ausstieg aber die am wenigsten gefahrgeneigte Art ist, den erhöhten Einsatzort zu erreichen, kann unter Einhaltung bestimmter Voraussetzungen dieser auch außerhalb der Grundstellung erfolgen. Die Verwendung geeigneter PSAgA ist dazu eine der Voraussetzungen, aber nicht die einzige. Unter welchen Bedingungen ein sicherer Ein- und Ausstieg möglich ist, beschreibt die Handlungsanleitung „Hubarbeitsbühnen: Sicherer Überstieg“ der internationalen Fachgruppe „Absturzsicherung“ D‑A-CH‑S. Hier ein paar wesentliche Aspekte:
- Die Bühne muss über eine geeignete Tür verfügen und beim Aus- und Einstieg dürfen keine zusätzlichen dynamischen Kräfte entstehen (z. B. kann eine Teleskopbühne durch Springen umkippen).
- Beauftragte Personen müssen für diese Situation anhand einer gesonderten Betriebsanweisung unterwiesen und geschult sein (projektspezifische Arbeitsanweisung).
- Die Arbeitsbühne muss ausschließlich für diese Arbeiten zur Verfügung stehen und darf im Moment des Aus- und Einstiegs nicht bewegt werden (unbeabsichtigtes Betätigen der Steuerung ausschließen, z. B. durch Not-Aus)!
- Eine zweite Person bleibt im Korb und überwacht die ausgestiegene Person.
- Im Arbeitskorb wird Rettungsausrüstung mitgeführt, um eine Rettung durch eigene Mittel zu gewährleisten.
- Sicherstellung einer wirksamen Kommunikation zwischen Bodenpersonal und den in der Höhe Arbeitenden.
- Beim Aus- und Einstieg erfolgt die Sicherung durch PSAgA unter Verwendung eines zweisträngigen falldämpfenden Verbindungsmittels mit einer Systemlänge von max. 1,80 m an einem ausreichend tragfähigen Anschlagpunkt ( 6 kN) am Bauwerk.
Welche zusätzliche Ausrüstung benötige ich?
Unabhängig von der Arbeitshöhe besteht für alle Montage‑, Bau- und Wartungstätigkeiten eine Helmpflicht. Diese wird grundsätzlich mit einem Helm nach EN 397 erfüllt. Achten Sie dabei auf die Ausstattung mit Kinnriemen. Weitere Ausrüstungen ergeben sich durch die Art der Tätigkeit (Augenschutz, Gehörschutz etc.).
Wie lange darf ich die PSAgA einsetzten?
Über die maximale Lebensdauer der PSAgA informiert die Bedienungsanleitung der einzelnen Hersteller. Wenn das Alter aufgrund fehlender oder nicht mehr lesbarer Angaben auf den Produkten nicht erkennbar ist, sind diese ablegereif. Außerdem sind alle an einem Absturz beteiligten Produkte der weiteren Benutzung zu entziehen.
Folgekosten: Wie muss die Ausrüstung geprüft werden?
Alle Produkte PSAgA unterliegen einer mindestens jährlichen Sichtprüfung durch einen Sachkundigen nach DGUV 312–906. Zusätzlich ist die Ausrüstung vor jeder Verwendung augenscheinlich durch den Anwender zu überprüfen.
Manche Produkte wie z. B. Höhensicherungsgeräte unterliegen bei vielen Herstellern einer zusätzlichen Revision. Diese ist kostspielig. Sie müssen nicht nur die Revisionskosten berücksichtigen, sondern auch den großen logistischen Aufwand. Zudem können Sie während der Zeit, in der die Geräte zur Überprüfung aus dem Haus sind, diese nicht benutzen und benötigen zusätzliche Ersatzgeräte. Wenn Sie diese Folgekosten vermeiden wollen, achten Sie beim Kauf auf revisionsfreie Ausrüstung, die nur der Sichtprüfung unterliegt.
Welche Ausbildung braucht der Bediener einer Hubarbeitsbühne?
Das sichere Bedienen einer Hubarbeitsbühne erfordert eine Ausbildung. Details hierzu finden sich im DGUV Grundsatz 308–008 und in verschiedenen Fachbereich Aktuell Publikationen (FHBL-002, FBPSA-010). Neben der technischen Bedienung der Arbeitsbühne sind dies im Wesentlichen die Unterweisung der Anwender in der Benutzung von PSAgA inklusive der Durchführung von praktischen Übungen zum richtigen Anlegen der Schutzausrüstung.
Sichergestellt werden muss die Organisation der regelmäßigen Prüfungen und der Sichtprüfung vor der Benutzung. Besonders wichtig ist die Planung von Rettungsmaßnahmen und das Einüben der Funktion des Notablasses. Es muss zudem sichergestellt sein, dass eine zweite Person, die im Umgang mit dem Notablass der Arbeitsbühne vertraut ist, sich in der Nähe der Bühne aufhält, um im Notfall sofort zu reagieren.
Fazit
Bevor Sie PSAgA kaufen, informieren Sie sich und berücksichtigen Sie die hier vorgestellten Empfehlungen und Regeln. Nicht alle der im Internet für das Arbeiten in mobilen Hubarbeitsbühnen angebotenen Sets erfüllen die Zulassung dafür! Laden Sie sich vorab das Zertifikat und die Bedienungsanleitung von der Webseite des Herstellers und lesen Sie diese aufmerksam durch. Eine Persönliche Schutzausrüstung verlangt immer die korrekte Zusammenstellung, die richtige Ausbildung und die richtige Anwendung durch die Benutzer!
Literatur
- DGUV Grundsatz 308–008
- DGUV Information 208–019
- IPAF Globaler Sicherheitsbericht MEWP 2020
- Handlungsanleitung „Hubarbeitsbühnen: Sicherer Überstieg“ der Fachgruppe „Absturzsicherung“ D‑A-CH‑S
- Fachbereich Aktuell Publikation FBHL-002 „Fahrbare Hubarbeitsbühnen – Benutzung von persönlicher Schutzausrüstung gegen Absturz“
- Fachbereich Aktuell Publikation FBPSA-010 „PSA gegen Absturz in Arbeitsbühnen von fahrbaren Hubarbeitsbühnen“
Autor: Uwe Reber
Business Development Manager Fallprotection CEER
E.Mail: Uwe.Reber@msasafety.com
MSA Deutschland GmbH