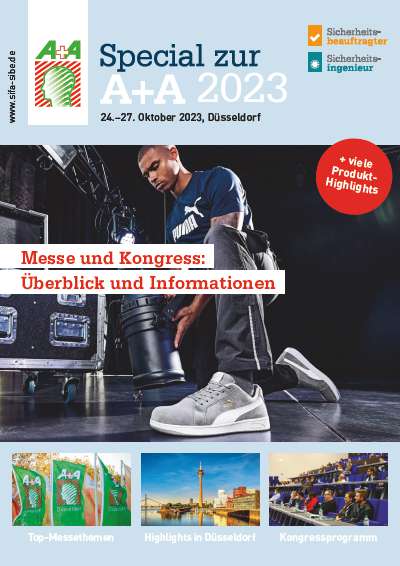Um Verhalten ändern zu können, muss man zunächst verstehen, warum sich Menschen so verhalten, wie sie es tun. Für den Bereich des arbeitssicheren Verhaltens hat sich die „Performance Diagnostic Checklist – Safety“ (PDC‑S) als nützlich erwiesen, um Schwachstellen und Ressourcen zu identifizieren, die Einfluss auf das sichere und riskante
Unsere Webinar-Empfehlung
Es gibt viele Fälle, in denen die Fallhöhe für eine herkömmliche Absturzsicherung nicht ausreicht. Beispiele für Arbeiten in geringer Höhe sind z.B. der Auf- und Abbau von Gerüsten, die Wartung von Industrieanlagen und Arbeiten in Verladehallen sowie Anwendungen in der Bahn und…
Teilen:









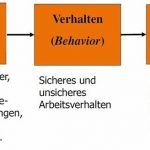


 SifaPlus-Beiträge und das große Archiv erhalten!
SifaPlus-Beiträge und das große Archiv erhalten!