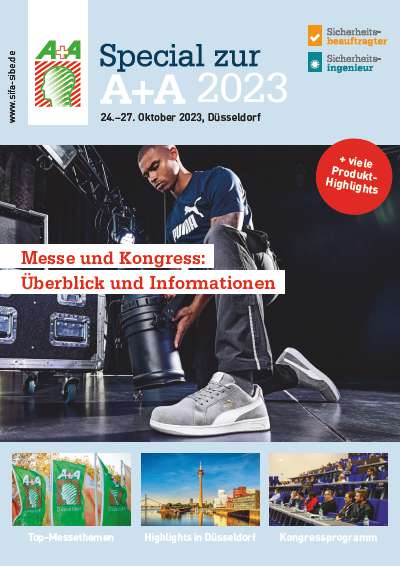Bezugnehmend auf den Beitrag in Sicherheitsingenieur 10/2019 ist der Arbeitgeber auch dafür verantwortlich, im Bereich der Elektrotechnik eine geeignete Organisation zu schaffen und fachlich Verantwortliche, insbesondere die Verantwortlichen Elektrofachkräfte passend in die betrieblichen Strukturen einzubinden. Der nachfolgende Beitrag zeigt ausgewählte Schnittstellen auf, welche aus Sicht der Führungskräfte sowie Fachkräfte
Unsere Webinar-Empfehlung
Es gibt viele Fälle, in denen die Fallhöhe für eine herkömmliche Absturzsicherung nicht ausreicht. Beispiele für Arbeiten in geringer Höhe sind z.B. der Auf- und Abbau von Gerüsten, die Wartung von Industrieanlagen und Arbeiten in Verladehallen sowie Anwendungen in der Bahn und…
Teilen:















 SifaPlus-Beiträge und das große Archiv erhalten!
SifaPlus-Beiträge und das große Archiv erhalten!