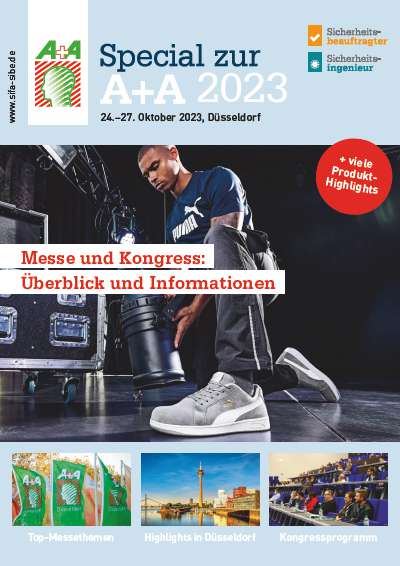Die Anzahl an meldepflichtigen Arbeitsunfällen durch Auszubildende zeigt einen alarmierenden Wert: Allein im Jahre 2017 waren 34.400 Auszubildende hiervon betroffen. Sechs Ereignisse endeten sogar tödlich (DGUV, 2019). Bei Jugendlichen bis zu einem Alter von 25 Jahren sind sogar rund 170.000 meldepflichtigen Arbeitsunfälle pro Jahr zu verzeichnen. Im Folgenden lesen
Unsere Webinar-Empfehlung
Es gibt viele Fälle, in denen die Fallhöhe für eine herkömmliche Absturzsicherung nicht ausreicht. Beispiele für Arbeiten in geringer Höhe sind z.B. der Auf- und Abbau von Gerüsten, die Wartung von Industrieanlagen und Arbeiten in Verladehallen sowie Anwendungen in der Bahn und…
Teilen:










 SifaPlus-Beiträge und das große Archiv erhalten!
SifaPlus-Beiträge und das große Archiv erhalten!