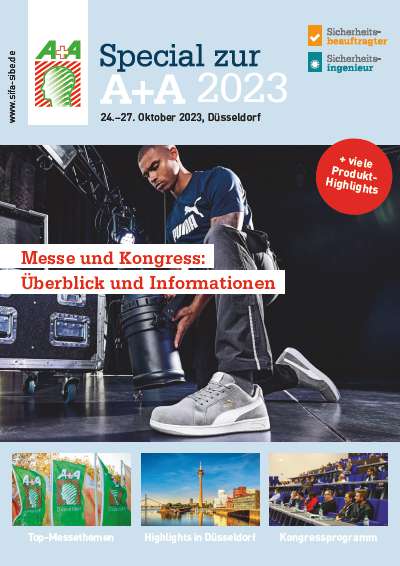Konventionelle Feuerlöschanlagen, insbesondere der typische Sprinkler, haben sich bestens bewährt. Mit der fortschreitenden technologischen Weiterentwicklung erhöhen sich die Brandlasten jedoch wesentlich, die in den Schutzbereichen befindlichen Stoffe bilden mit ihrer Brandlast ein erhebliches Gefahrenpotential. Daher werden spezifischere Löschverfahren zukünftig immer unerlässlicher.
Nach der Bestimmung der Art,
Unsere Webinar-Empfehlung
Es gibt viele Fälle, in denen die Fallhöhe für eine herkömmliche Absturzsicherung nicht ausreicht. Beispiele für Arbeiten in geringer Höhe sind z.B. der Auf- und Abbau von Gerüsten, die Wartung von Industrieanlagen und Arbeiten in Verladehallen sowie Anwendungen in der Bahn und…
Teilen:










 SifaPlus-Beiträge und das große Archiv erhalten!
SifaPlus-Beiträge und das große Archiv erhalten!