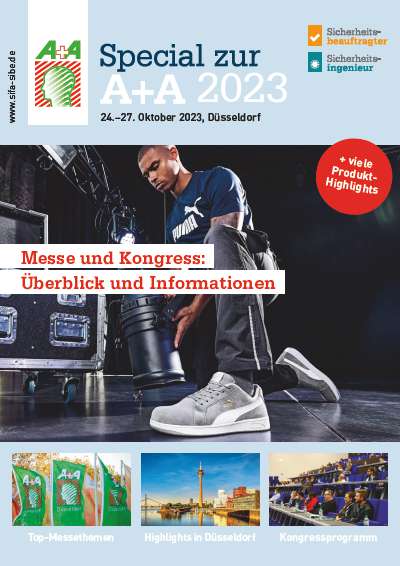Das Arbeiten in Behältern und engen Räumen, landläufig auch als Befahren von Behältern bezeichnet, zählt zu den gefährlichsten Tätigkeiten. Ob in der gewerblichen Wirtschaft, in der Landwirtschaft oder in Einzelfällen sogar im häuslichen Bereich – immer wieder kommt es zu schweren, oft tödlichen Unfällen.
Für die
Unsere Webinar-Empfehlung
Es gibt viele Fälle, in denen die Fallhöhe für eine herkömmliche Absturzsicherung nicht ausreicht. Beispiele für Arbeiten in geringer Höhe sind z.B. der Auf- und Abbau von Gerüsten, die Wartung von Industrieanlagen und Arbeiten in Verladehallen sowie Anwendungen in der Bahn und…
Teilen:











 SibePlus-Beiträge und das große Archiv erhalten!
SibePlus-Beiträge und das große Archiv erhalten!