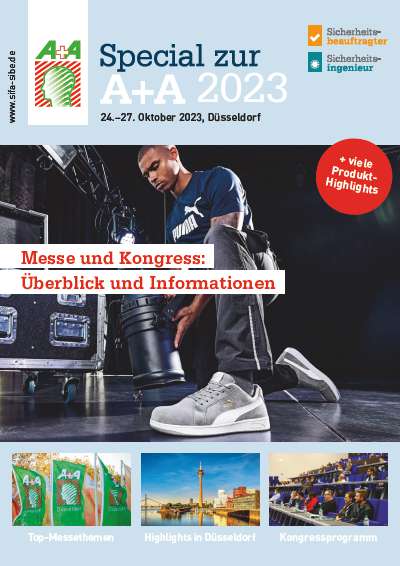Basierend auf dem Arbeitsschutzgesetz von 1996 kann nach fast 25 Jahren die Gefährdungsbeurteilung (GBU) als etablierte Präventionsmaßnahme im Arbeitsschutz angesehen werden. In den vergangenen Jahren kamen einige neue Themen dazu, und auch die EDV hatte ihre Auswirkungen. Im Folgenden finden Sie dazu einen Überblick.
Was ist
Unsere Webinar-Empfehlung
15.06.23 | 10:00 Uhr | Maßnahmenableitung, Wirksamkeitsüberprüfung und Fortschreibung – drei elementare Bausteine in jeder Gefährdungsbeurteilung, die mit Blick auf psychische Belastung bislang weniger Beachtung finden.
Teilen:








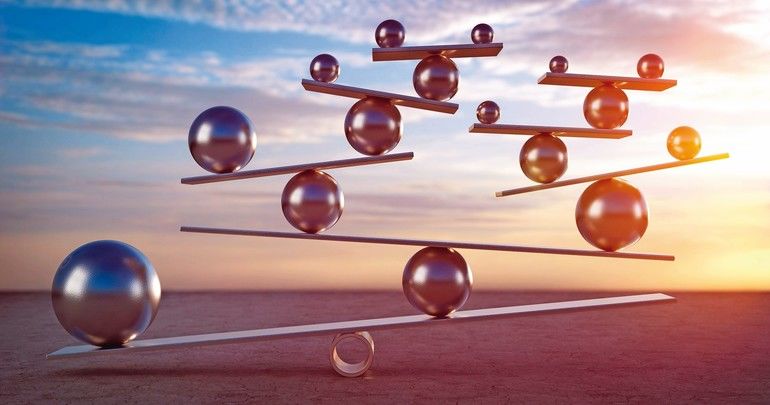

 SifaPlus-Beiträge und das große Archiv erhalten!
SifaPlus-Beiträge und das große Archiv erhalten!