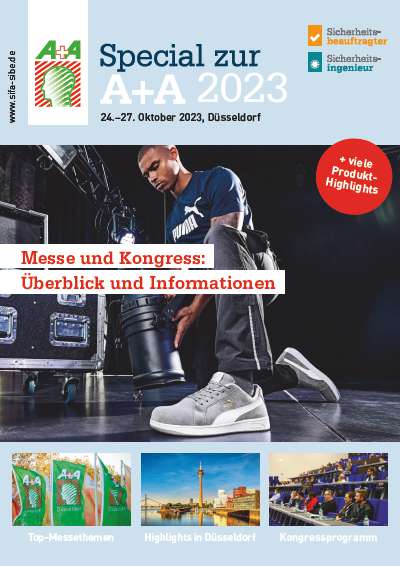Die Qualifizierungsempfehlungen der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie (GDA) zu psychischen Belastungen definieren auch Aufgaben für Fachkräfte für Arbeitssicherheit und Betriebsärzte. Dazu gehört die Wahrnehmung einer Lotsenfunktion. Die Übernahme dieser Aufgabe ist auch solchen Mitarbeitern möglich, die vornehmlich technisch ausgebildet sind und üblicherweise eher wenig Bezug zum Thema „Psyche“ haben.
Unsere Webinar-Empfehlung
Es gibt viele Fälle, in denen die Fallhöhe für eine herkömmliche Absturzsicherung nicht ausreicht. Beispiele für Arbeiten in geringer Höhe sind z.B. der Auf- und Abbau von Gerüsten, die Wartung von Industrieanlagen und Arbeiten in Verladehallen sowie Anwendungen in der Bahn und…
Teilen:










 SifaPlus-Beiträge und das große Archiv erhalten!
SifaPlus-Beiträge und das große Archiv erhalten!