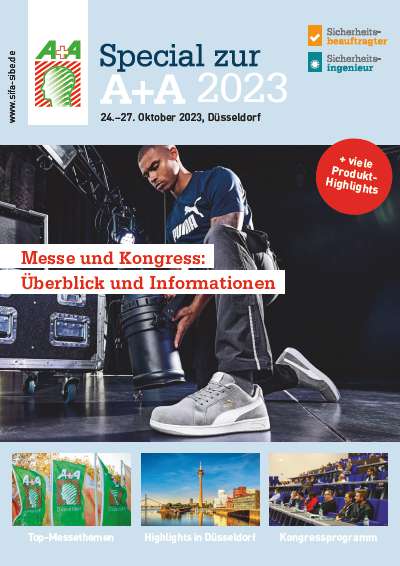Die Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen ist in vielen Betrieben noch ein weißer Fleck auf der Landkarte des Arbeitsschutzes. Das liegt unter anderem auch daran, dass traditionell psychische Belastungen nicht als Betätigungsfeld der Fachkraft für Arbeitssicherheit gesehen wurden, was aber keine zeitgemäße Sichtweise mehr ist.
Nach § 6
Unsere Webinar-Empfehlung
Es gibt viele Fälle, in denen die Fallhöhe für eine herkömmliche Absturzsicherung nicht ausreicht. Beispiele für Arbeiten in geringer Höhe sind z.B. der Auf- und Abbau von Gerüsten, die Wartung von Industrieanlagen und Arbeiten in Verladehallen sowie Anwendungen in der Bahn und…
Teilen:










 SifaPlus-Beiträge und das große Archiv erhalten!
SifaPlus-Beiträge und das große Archiv erhalten!