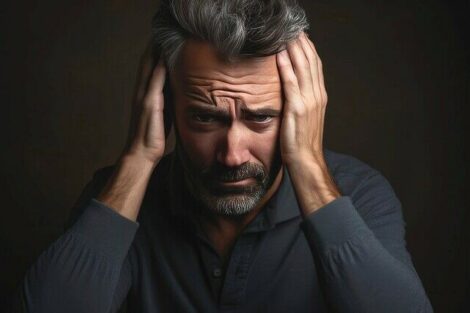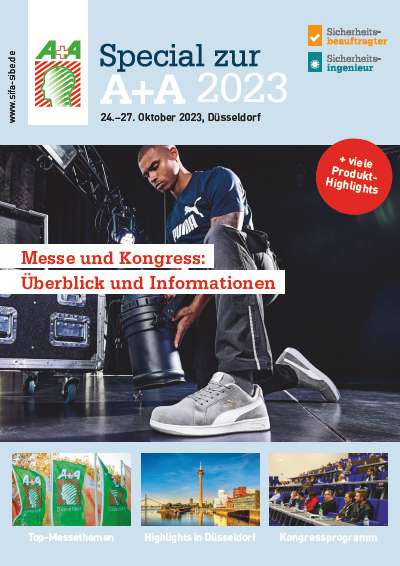In der Chemiefabrik, im Hochofen oder in der Sägemühle, jedes Jahr ereignen sich schwere und schwerste Unfälle, die mit Explosionen einhergehen. In einer Serie von drei Artikeln beleuchtet unser Fachautor Ursachen und Hintergründe von Explosionsunfällen. Angefangen mit dem „Klassiker“: Die Reaktion mit Sauerstoff.
„So wichtig wie
Unsere Webinar-Empfehlung
Es gibt viele Fälle, in denen die Fallhöhe für eine herkömmliche Absturzsicherung nicht ausreicht. Beispiele für Arbeiten in geringer Höhe sind z.B. der Auf- und Abbau von Gerüsten, die Wartung von Industrieanlagen und Arbeiten in Verladehallen sowie Anwendungen in der Bahn und…
Teilen:












 SibePlus-Beiträge und das große Archiv erhalten!
SibePlus-Beiträge und das große Archiv erhalten!