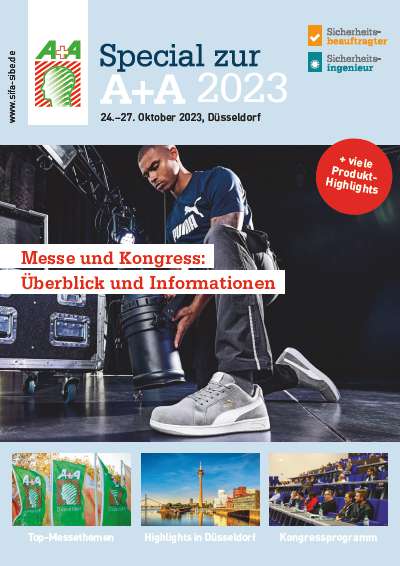In Teil 1 des Beitrags haben wir geschildert, dass der Betreiber nur in drei Ausnahmesituationen zum Hersteller wird und in Konsequenz dann die entsprechenden Produktsicherheitspflichten und formelle Anforderungen – vollständig – umsetzen muss, ansonsten aber kein Wirtschaftsakteur gemäß Inverkehrbringensrecht ist. In diesem Teil 2 begründen wir unsere Rechtsansicht, dass
Unsere Webinar-Empfehlung
Es gibt viele Fälle, in denen die Fallhöhe für eine herkömmliche Absturzsicherung nicht ausreicht. Beispiele für Arbeiten in geringer Höhe sind z.B. der Auf- und Abbau von Gerüsten, die Wartung von Industrieanlagen und Arbeiten in Verladehallen sowie Anwendungen in der Bahn und…
Teilen:










 SifaPlus-Beiträge und das große Archiv erhalten!
SifaPlus-Beiträge und das große Archiv erhalten!