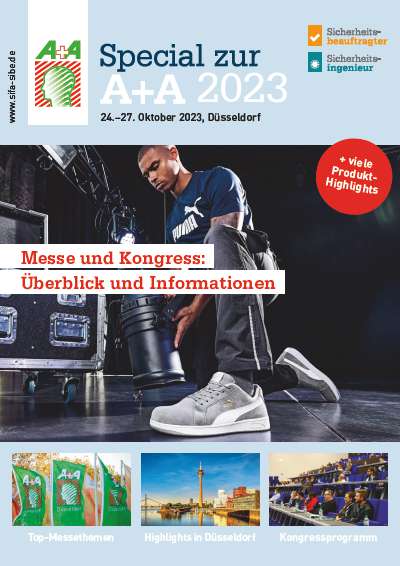Am 1. Januar 2018 trat das neue Mutterschutzgesetz (MuSchG) in Kraft. Das Mutterschutzrecht wurde damit umfassend reformiert. Die Novelle bringt Änderungen für schwangere und stillende Frauen, den Arbeitgeber und weitere beteiligte Personen mit sich. Lesen Sie mehr über die wesentlichen Änderungen für den betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutz.
Unsere Webinar-Empfehlung
Es gibt viele Fälle, in denen die Fallhöhe für eine herkömmliche Absturzsicherung nicht ausreicht. Beispiele für Arbeiten in geringer Höhe sind z.B. der Auf- und Abbau von Gerüsten, die Wartung von Industrieanlagen und Arbeiten in Verladehallen sowie Anwendungen in der Bahn und…
Teilen:










 SibePlus-Beiträge und das große Archiv erhalten!
SibePlus-Beiträge und das große Archiv erhalten!