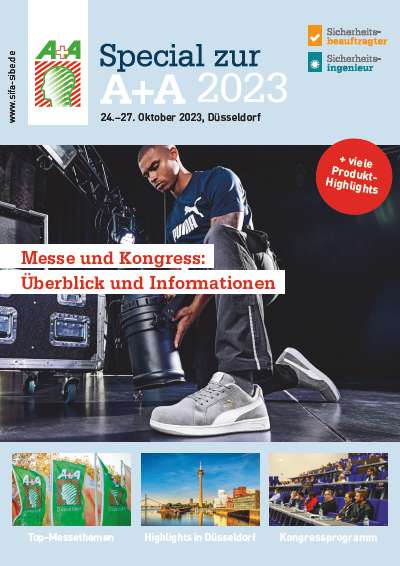Nachdem der erste Entwurf für ein „Mobile-Arbeit-Gesetz“ (MAG) im Herbst des vergangenen Jahres vom Kanzleramt gestoppt wurde, hat das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) am 14. Januar 2021 einen neuen Referentenentwurf zur weiteren Abstimmung vorgelegt. Den wesentlichen Inhalt des Gesetzentwurfs beleuchtet der nachfolgende Beitrag.
Der
Unsere Webinar-Empfehlung
Es gibt viele Fälle, in denen die Fallhöhe für eine herkömmliche Absturzsicherung nicht ausreicht. Beispiele für Arbeiten in geringer Höhe sind z.B. der Auf- und Abbau von Gerüsten, die Wartung von Industrieanlagen und Arbeiten in Verladehallen sowie Anwendungen in der Bahn und…
Teilen:










 SifaPlus-Beiträge und das große Archiv erhalten!
SifaPlus-Beiträge und das große Archiv erhalten!