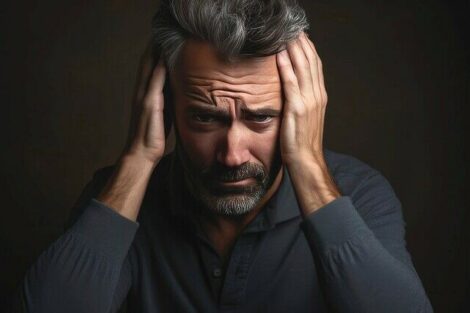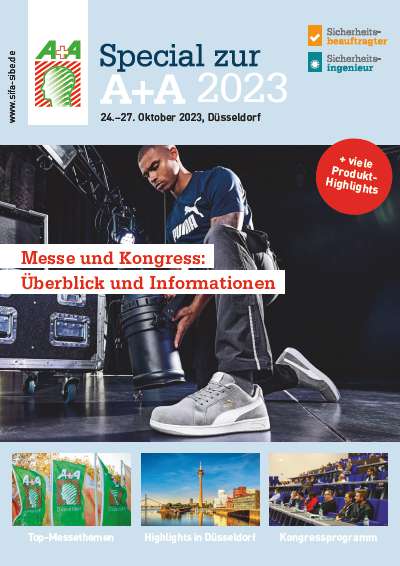An vielen Stellen des staatlichen und berufsgenossenschaftlichen Arbeitsschutzregelwerks wird die Pflicht zur Unterweisung dem Arbeitgeber beziehungsweise Unternehmer oder dessen nach §13 ArbSchG / §13 DGUV-Vorschrift 1 verantwortlichen Personen aufgegeben. Jedoch schweigen sich alle Rechtsgrundlagen — bis auf die Gefahrstoffverordnung — über eine Aufbewahrung der Nachweise aus.
Unsere Webinar-Empfehlung
Es gibt viele Fälle, in denen die Fallhöhe für eine herkömmliche Absturzsicherung nicht ausreicht. Beispiele für Arbeiten in geringer Höhe sind z.B. der Auf- und Abbau von Gerüsten, die Wartung von Industrieanlagen und Arbeiten in Verladehallen sowie Anwendungen in der Bahn und…
Teilen:








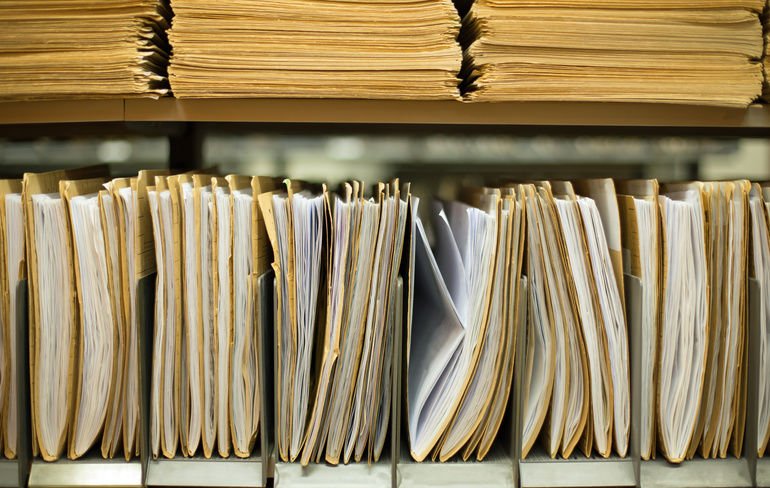

 SifaPlus-Beiträge und das große Archiv erhalten!
SifaPlus-Beiträge und das große Archiv erhalten!