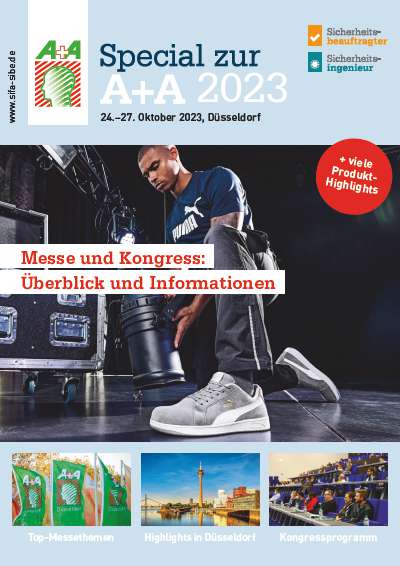Auch 2020 wurden wieder die neuen Vorschläge der Ständigen Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG-Arbeitsstoffkommission) für MAK- und BAT-Werte sowie Stoffbewertungen im Juli veröffentlicht und dem Bundesarbeitsministerium übergeben. In diesem Jahr ist die neue MAK-Werte-Liste jedoch auf einer neuen Internet-Plattform (https://series.publisso.de/pgseries/overview/mak) erschienen.
Diese
Unsere Webinar-Empfehlung
Es gibt viele Fälle, in denen die Fallhöhe für eine herkömmliche Absturzsicherung nicht ausreicht. Beispiele für Arbeiten in geringer Höhe sind z.B. der Auf- und Abbau von Gerüsten, die Wartung von Industrieanlagen und Arbeiten in Verladehallen sowie Anwendungen in der Bahn und…
Teilen:








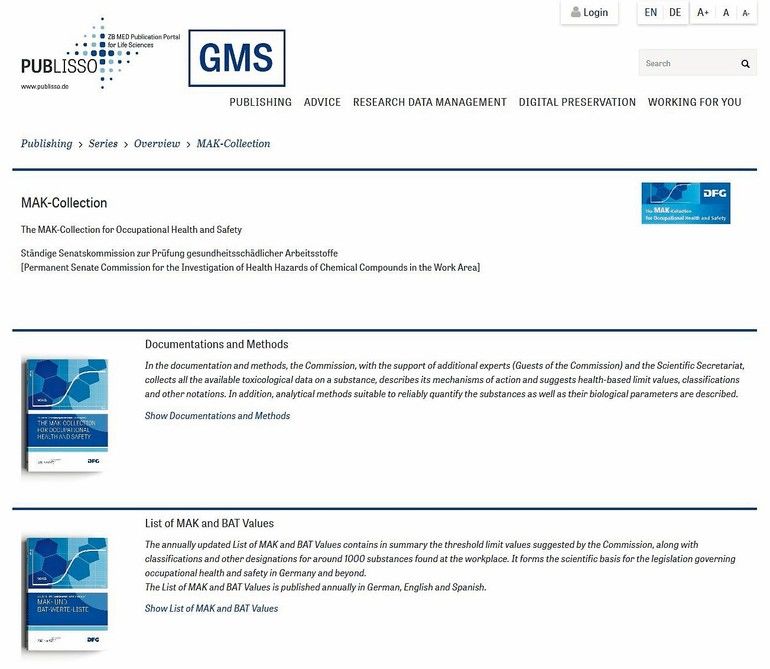

 SifaPlus-Beiträge und das große Archiv erhalten!
SifaPlus-Beiträge und das große Archiv erhalten!