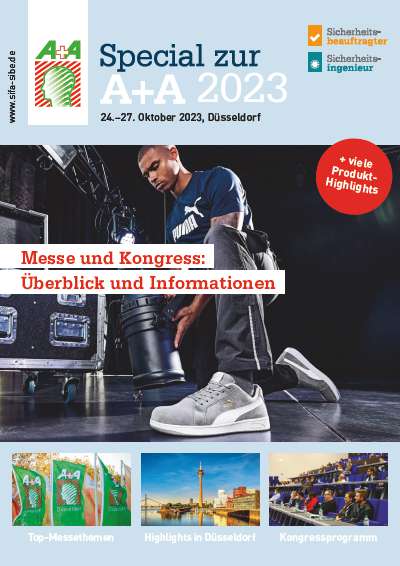Wer den Führerschein besteht, darf hinters Steuer. Doch den meisten Fahranfängern mangelt es noch an Erfahrung und Selbstreflexion, wie das erhöhte Unfallrisiko in der Altersgruppe der 18- bis 24-Jährigen zeigt. Weit weniger gefährdet sind die jungen Leute, die das Modell „Begleitetes Fahren ab 17“ nutzen: Mit einem „alten Hasen“
Unsere Webinar-Empfehlung
Es gibt viele Fälle, in denen die Fallhöhe für eine herkömmliche Absturzsicherung nicht ausreicht. Beispiele für Arbeiten in geringer Höhe sind z.B. der Auf- und Abbau von Gerüsten, die Wartung von Industrieanlagen und Arbeiten in Verladehallen sowie Anwendungen in der Bahn und…
Teilen:














 SifaPlus-Beiträge und das große Archiv erhalten!
SifaPlus-Beiträge und das große Archiv erhalten!