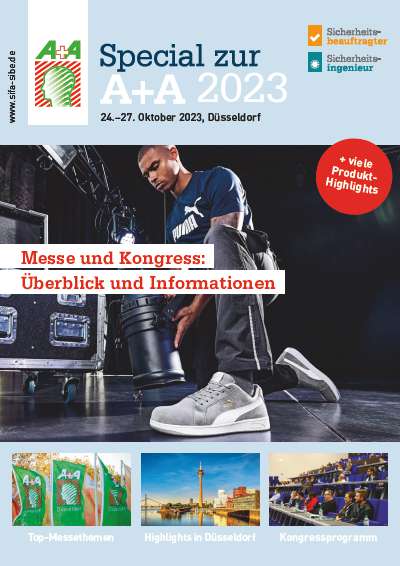Ganz gleich, ob in der Mikroelektronik-Industrie an hochsensiblen Halbleitern geforscht wird oder in der Pharma-Branche neue Medikamente entwickelt und produziert werden: In den Reinräumen ist höchste Reinheit unabdingbare Pflicht. Damit die Konzentration luftgetragener Partikel und Keime so gering wie möglich bleibt, gelten in Reinräumen strenge Hygiene- und Dekontaminierungs-Vorschriften. Das
Unsere Webinar-Empfehlung
Es gibt viele Fälle, in denen die Fallhöhe für eine herkömmliche Absturzsicherung nicht ausreicht. Beispiele für Arbeiten in geringer Höhe sind z.B. der Auf- und Abbau von Gerüsten, die Wartung von Industrieanlagen und Arbeiten in Verladehallen sowie Anwendungen in der Bahn und…
Teilen:










 SifaPlus-Beiträge und das große Archiv erhalten!
SifaPlus-Beiträge und das große Archiv erhalten!