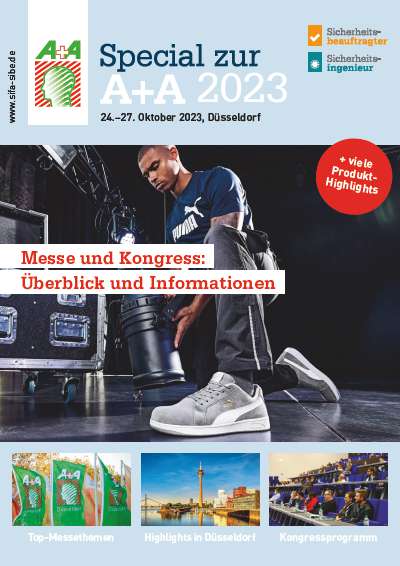Die Prüfung elektrischer Anlagen und Betriebsmittel ist spätestens seit dem Inkrafttreten der Unfallverhütungsvorschrift „Elektrische Anlagen und Betriebsmittel“ im Jahr 1979 geregelt. Durch die Einführung der Betriebssicherheitsverordnung ergaben sich allerdings inzwischen zum Teil neue Begriffe und Anforderungen. Dieser Beitrag soll häufige Missverständnisse bei der Auslegung der Verordnungen ausräumen und darlegen,
Unsere Webinar-Empfehlung
Es gibt viele Fälle, in denen die Fallhöhe für eine herkömmliche Absturzsicherung nicht ausreicht. Beispiele für Arbeiten in geringer Höhe sind z.B. der Auf- und Abbau von Gerüsten, die Wartung von Industrieanlagen und Arbeiten in Verladehallen sowie Anwendungen in der Bahn und…
Teilen:











 SifaPlus-Beiträge und das große Archiv erhalten!
SifaPlus-Beiträge und das große Archiv erhalten!