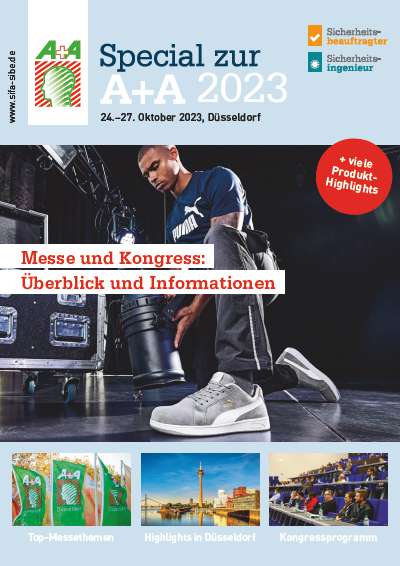Jede Fachkraft für Arbeitssicherheit kennt die Probleme, wenn es um PSA geht. Neben der richtigen Auswahl ist auch die Trageakzeptanz von großer Bedeutung. Dabei hängt sogar beides voneinander ab.
Ziel jedes Akteurs im Arbeitsschutz ist es, Gefahrenquellen mit dazugehörigen Gefährdungsfaktoren (schädigende Energie) so zu minimieren, dass
Unsere Webinar-Empfehlung
Es gibt viele Fälle, in denen die Fallhöhe für eine herkömmliche Absturzsicherung nicht ausreicht. Beispiele für Arbeiten in geringer Höhe sind z.B. der Auf- und Abbau von Gerüsten, die Wartung von Industrieanlagen und Arbeiten in Verladehallen sowie Anwendungen in der Bahn und…
Teilen:










 SifaPlus-Beiträge und das große Archiv erhalten!
SifaPlus-Beiträge und das große Archiv erhalten!