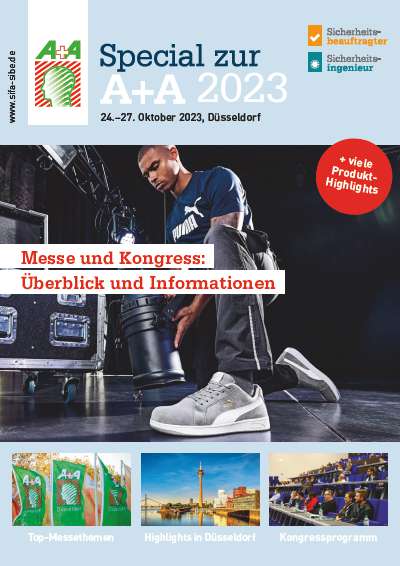Einerseits ist Sicherheit ein psychologisches Grundbedürfnis des Menschen, andererseits entpuppt sich Sicherheit als Illusion. Den illusionären Charakter einer äußeren Sicherheit haben wir gerade alle in erhöhtem Ausmaß anlässlich der Coronakrise erfahren. Was kann jede und jeder daraus lernen, wie sehr gehört Unsicherheit zum Leben und Arbeiten?
Dieser
Unsere Webinar-Empfehlung
29.02.24 | 10:00 Uhr | Spielsucht, Kaufsucht, Arbeitssucht, Mediensucht – was genau verbirgt sich hinter diesen Begriffen? Wie erkennt man stoffungebundene Süchte? Welche Rolle spielt die Führungskraft bei der Erkennung, Vermeidung und Bewältigung von Suchtproblemen am Arbeitsplatz?…
Teilen:










 SifaPlus-Beiträge und das große Archiv erhalten!
SifaPlus-Beiträge und das große Archiv erhalten!