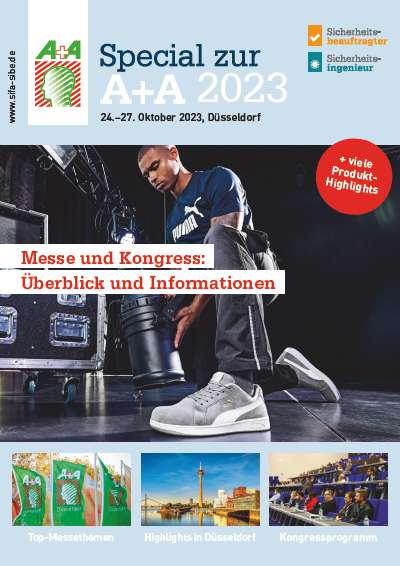§ 4 Allgemeine Grundsätze … … 5. individuelle Schutzmaßnahmen sind nachrangig zu anderen Maßnahmende.kim.content.generate.input.Fnote@33b66214 – so verlangt es das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) und diese Forderung ist – wie auch alle anderen Bestimmungen des Gesetzes – nicht verhandel- oder interpretierbar. Dennoch sind Persönliche Schutzausrüstungen (PSA) heute allgegenwärtig und weder aus dem beruflichen
Unsere Webinar-Empfehlung
Es gibt viele Fälle, in denen die Fallhöhe für eine herkömmliche Absturzsicherung nicht ausreicht. Beispiele für Arbeiten in geringer Höhe sind z.B. der Auf- und Abbau von Gerüsten, die Wartung von Industrieanlagen und Arbeiten in Verladehallen sowie Anwendungen in der Bahn und…
Teilen:











 SifaPlus-Beiträge und das große Archiv erhalten!
SifaPlus-Beiträge und das große Archiv erhalten!