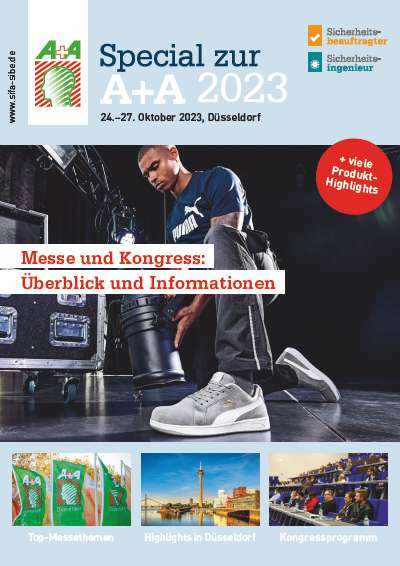Nicht nur die Digitalisierung und die Globalisierung stellen psychische Belastungsfaktoren am Arbeitsplatz dar. Zunehmend führen auch Arbeitsverdichtung und permanenter Change zu Konflikten und Reibungsverlusten in Arbeit und Beruf. Ein professionelles Konfliktmanagement kann dabei helfen, sich abzeichnende oder schon ausgebrochene Konflikte zu fokussieren und zu lösen.
Die
Unsere Webinar-Empfehlung
29.02.24 | 10:00 Uhr | Spielsucht, Kaufsucht, Arbeitssucht, Mediensucht – was genau verbirgt sich hinter diesen Begriffen? Wie erkennt man stoffungebundene Süchte? Welche Rolle spielt die Führungskraft bei der Erkennung, Vermeidung und Bewältigung von Suchtproblemen am Arbeitsplatz?…
Teilen:










 SifaPlus-Beiträge und das große Archiv erhalten!
SifaPlus-Beiträge und das große Archiv erhalten!