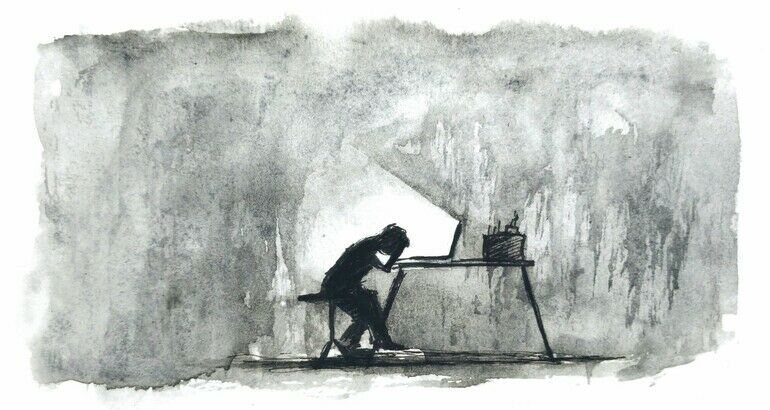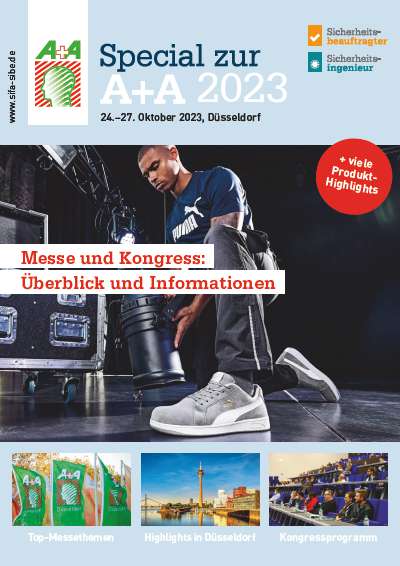Die junge Notärztin war über ihn gebeugt. Ihr Blick schien hochkonzentriert und ernst, sehr ernst. Die Sanitäter kamen gerade mit der Trage vom Rettungswagen zurück. Dann stand sie auf, drehte sich zum Ersthelfer um und lobte ihn: „Ohne Ihren Einsatz hätte er keine Chance gehabt – jetzt zumindest eine kleine.” Die Geschäftsführerin Cora Schneider, die sofort herbeigeeilt war, hatte schon selbst roboterhaft mehrere Stellwände zum Sichtschutz aufgestellt. Auf der anderen Seite der Wand waren die fünf Kollegen, die eben noch an Jürgens Vertriebsschulung teilgenommen hatten, kreidebleich. Drei andere aus den Nebengebäuden, die zuvor wie Frau Schneider auch über Video teilnahmen, waren bereits abgemeldet. Was die Sache aber nicht besser machte. Auch, wenn es keiner aussprach, alle warteten jetzt auf die Reaktion der sichtlich geschockten Geschäftsführerin. Wie wird sie reagieren?
Schockerlebnis am Arbeitsplatz
Der Rettungswagen mit dem „fitten Jürgen“ hat inzwischen den Hof bei voller Alarmfahrt verlassen. Der Geschäftsführerin bot sich vor Ort ein Bild des Grauens. Petra, einer Kollegin, war zum Heulen, das erste Päckchen Taschentücher war schon durch. Jan, der neue Kollege, der direkt in der anderen Ecke des Raumes stand, wirkte geistig abwesend, schaute verloren in die Ferne. Die Betriebsrätin Jasmin zitterte am ganzen Körper und meinte nur, dass sie jetzt erst mal raus muss – eine rauchen gehen. Sie ginge nur auf den Hof und käme gleich wieder. Jenny, die Kollegin aus dem Einkauf, schien mit dem Handy zu telefonieren. Ihrem Gesicht und den Gesten nach zu urteilen, erzählte sie einer vertrauten Person, was geschehen war. Und das war etwas, was sie noch gar nicht fassen konnte und was mit Sicherheit noch einige Tage nachwirken wird. Insbesondere, aber das wussten nur zwei Eingeweihte, war sie im vergangenen Jahr für einige Monate Jürgens heiße Büroaffäre.
Eine Geschichte aus dem wahren Leben, die so ähnlich passiert ist und in diesen Tagen immer wieder passiert. Das, was der „fitte Jürgen“ erlebt, wird inzwischen von vielen als normales Lebensrisiko angesehen. Hingegen, und das wissen viele nicht, für die Augen- und Ohrenzeugen ist es ein Arbeitsunfall. Cora Schneider, die Geschäftsführerin, muss sich jetzt kümmern. Der unbequeme Anruf bei Jürgens Frau steht ihr gleich bevor. Sie bittet daher sowohl die Betriebsärztin als auch die Fachkraft für Arbeitssicherheit um ihre Hilfe: „Sie beraten mich ja gerade bei Arbeitsunfällen – was kann, soll, was muss ich nun tun?“ Sie brauchte ganz offensichtlich deren professionelle Hilfe. Aber von der anderen Seite kam nur betretenes Schweigen.
Verhalten nach Beobachten eines gesundheitlichen Zusammenbruchs
Auf einer Fachtagung mit Arbeitsmedizinerinnen und ‑medizinern und Sifas im Frühjahr 2022 erzählte ich diese wahre, wenngleich anonymisierte Geschichte in kleiner abendlicher Runde. Abschließend stellte ich die Frage: „Was würden Sie tun?“
Erfahrungsgemäß sind erst einmal alle Blicke auf denjenigen gerichtet, der am Boden liegt, der den Infarkt hat, so wie in meiner Geschichte der „fitte Jürgen“. Wenn ich so manche Gespräche der letzten Jahre erinnere oder auch von ähnlichen Situationen lese, bleibt es auch meist dabei. Wenn der Rettungswagen den Hof verlassen hat, soll es einfach weitergehen wie zuvor. Aber genau das passiert kaum. Nach einem solchen Ereignis ist erst einmal Land unter. Mehr noch, jetzt wird es, gesetzlich begründet, zu einem Thema für die Arbeitssicherheit.
Im Sinne der klassischen Definition war Jürgen allerdings „nur“ ein internistischer Notfall; den eigentlichen Arbeitsunfall hatten die Augen- und Ohrenzeugen. Bei ihnen liegt infolgedessen möglicherweise auch eine psychische Belastung, vielleicht sogar eine Gefährdung vor. Ihr, im Eingang des Artikels geschildertes, Verhalten bietet bei allen einen Anlass, an dieser Stelle genauer hinzuschauen. Je nachdem, wie dieser Check ausfällt, sind Maßnahmen zu treffen. Die Beurteilung sollte zudem wiederholt werden, spätestens wenn klar ist, dass Jürgen nicht mehr ins Unternehmen zurückkehrt oder gar verstorben ist.
Tod und Trauer im Arbeitskontext
Schwere oder gar tödliche Arbeitsunfälle, die direkt in der Firma passieren, sind einer dieser Zugänge. Zahlenmäßig gehören sie zu den Kleinsten. Von der Gefährlichkeit für Unternehmen und Mitarbeitende her haben sie das größte Potenzial. Solche Ereignisse, aber noch viel mehr der Umgang damit, brennen sich unweigerlich in das Gedächtnis der Belegschaft ein. Sie finden somit Eingang in die „DNA“ des Unternehmens. Selbst jene Mitarbeitende, die nicht dabei waren, werden Teil dieser Geschichte. Dies potenziert sich, wenn mehrere Mitarbeitende betroffen sind. Die Bilder, dass Polizei und Behörden vor Ort waren und womöglich auch Presse und TV sowie die PSNV/Notfallseelsorge, bleiben in Erinnerung. Diese Geschichten werden dauerhaft mit unterschiedlichen Nuancen weitererzählt. Damit werden auch jene in das Ereignis mit hineingenommen, die zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht im Unternehmen arbeiteten.
Nicht, dass ein solches Ereignis nicht passieren könne, aber spätestens mit der Presse wird ohne Vorwarnung die komplette Sicherheit, die Unternehmenswerte und sämtliche Kommunikation schonungslos offengelegt. Jetzt steht im Fokus: „Kümmert sich die Führung beziehungsweise eine konkrete Führungskraft wertschätzend um die Mitarbeitenden, die direkt ein solches Ereignis miterlebt haben, oder schickt man die Mitarbeitenden unkommentiert nach Schichtschluss nach Hause?“ Die vorfindliche Antwort entscheidet über die Zukunft des Unternehmens. Glücklicherweise sind Arbeitsunfälle oder ein internistischer Notfall im Unternehmen als Todesursache eher gering.
Tod und Trauer mittelbar Teil des Arbeitsschutzes
Wenn es auch nicht unmittelbar Teil des betrieblichen Arbeitsschutzes ist, Mitarbeiter, die im Privaten direkt mit Tod und Trauer konfrontiert sind, tragen dies mit ins Unternehmen ein. Trauer ist kein Thema, das man vor dem Werkstor auszieht, auf einen Haken hängt und später wieder mitnimmt.
Im Folgenden möchte ich nur kurz einige Schlaglichter werfen: Seit Jahren liegt die Zahl aller Verstorbenen (Q:statista.de) bei rund 930.000, 2021 stieg sie auf 1,023 Millionen. Um diese Menschen wird von Nahestehenden getrauert. Trauer ist ein zutiefst menschlicher und individueller Prozess des Abschiednehmens, der mit Unterstützung oft schneller zu bewältigen ist. Bei gelingender Trauer wird das, was gewesen ist, ins Leben integriert, gewürdigt und dann geht das Leben, oftmals gestärkt, mit einem neuen Zeitabschnitt weiter. Unternehmen sollten daher ein Eigeninteresse haben, dass dies möglichst gut und zeitnah gelingt, um für sich entsprechende Belastungen und Einbußen zu minimieren.
Unterschätzt sind zudem, weil häufig unterm Radar, Fehl- oder stille Geburten. Hier sprechen die Fachleute von ungefähr 200.000 trauernden Elternpaaren pro Jahr. Hier zeigt sich bei Frauen häufig die Trauer in Wellen der Traurigkeit bis hin zur Depression; Männer flüchten oft in die Arbeit. Ein weiteres großes Tabu sind Suizide. Hier steht neben dem Erschrecken und der Trauer sofort eine Reihe weiterer Aspekte. Was könnte ein Eigenanteil sein, was hätte man anders machen können oder gar müssen? Sofern ein Kollege diesen Weg gewählt hat, ist für Teams professionelle Hilfe dringend angeraten. Das Thema ist nicht mit Bordmitteln auflösbar. Entscheidend für das Unternehmen ist, dass die Trauer der Mitarbeiter nicht die Trauer des Unternehmens wird.
Wer als Unternehmer oder Personalleiterin bei diesen großen Zahlen meint, dass Tod und Trauer in seinem Unternehmen seit Jahren keine Rolle spielen, könnte sich in einem Graufeld befinden. Ein Feld, das mit einem Mal sehr hell werden kann.
Tod und Trauer verändern persönliche Leistungsvoraussetzungen
Der Tod eines Nahestehenden erschüttert das Leben jedes Mitarbeiters unmittelbar. Für die Arbeitssicherheit gilt es daher, für diesen Moment die persönlichen Leistungsvoraussetzungen zu beurteilen. Zu viele Sorgen und zu wenig Schlaf bilden schon in normalen Zeiten eine brisante Mischung, die bisweilen mit Selbstmedikation kaschiert wird.
Kommt jedoch, wie im Trauerfall zusätzlich, eine solche massive organisatorische und eine emotionale Überforderung, beispielsweise im Blick auf eine Beisetzung, hinzu, steigt die Unaufmerksamkeit und damit häufig das Sicherheitsrisiko auch für Unternehmen. Was würde diesem Trauernden also jetzt helfen?
Auch sollte der Blick jetzt systemisch in Richtung Unternehmen gehen. Sind Tod und Trauer hier ein „erlaubtes“ Thema? Wird der Mitarbeiter wohlwollend und aktiv unterstützt oder muss er seine momentane Situation verstecken, was zusätzlichen Stress für ihn bedeutet? Welche Auswirkungen hat die Situation auf die Teams, in denen dieser Mitarbeiter eingebunden ist? Rücken diese mehr zusammen oder überträgt sich hier eine gewisse Depression auf die Gruppe und ihre Leistungen? Darüber hinaus ist zu schauen, ob er vom Unternehmen und den Kollegen unterstützt wird. Muss gar davon ausgegangen werden, dass der betroffene Mitarbeiter unter besondere Beobachtung gestellt oder gar ausgegrenzt wird? All diese Aspekte sollten daher in die Gefährdungsbeurteilung nach einem Trauerfall Eingang finden.
Unterstützung bei Tod und Trauer rechnet sich für Unternehmen
Als Fachkräfte für Arbeitssicherheit in Deutschland kennen wir diese Szene nur zu gut: Wir zeigen der Geschäftsführung einen für sie kritischen Bereich, haben sogar eine Lösung vorbereitet, und sofort beginnt das altbekannte Lamento der Kosten. Wird diese Karte gezogen, dann meist, um im nächsten Satz zu sagen, dass einem das zu teuer ist. Das Ganze hat schon fast rituellen Charakter.
Ob nun aus Kosten- oder aus Angstgründen, faktisch wird das Thema in diesem Moment strategisch aus dem Weg geräumt. Aus dem Jahr 2003 gibt es eine großangelegte Studie aus Nordamerika (Grief Recovery Institute), die mit eindeutigen Zahlen zum Thema: „Kosten von Tod und Trauer in den Unternehmen“ aufwartet. Bevor Sie hier nun weiterlesen, lade ich Sie zu einem kleinen Schätzspiel ein. Was schätzen Sie, wie viel Geld kostet das Thema „Tod und Trauer“ Unternehmen in Deutschland jährlich?
Ergänzend sollte gesagt werden, man machte für die Studie eine Gesamtkostenrechnung und bezog Verzögerungen, Produktionsausfälle, Unfälle usw. mit ein. Übrigens: Sucht man im deutschsprachigen Internet zum Thema „Kosten“ und „Tod in Unternehmen”, finden sich in den oberen Rängen meist die Beiträge, bis zu welchen Beträgen der Trauerkranz steuerfreundlich vom Unternehmen bezahlt werden kann.
Die Ersteller dieser kanadisch-amerikanischen Studie räumen sogar ein, dass sie einen Teil der Kosten, eben jene, die sie nicht konkret zuordnen konnten, außen vor ließen. Hier zählten sie beispielsweise Alkoholmissbrauch und Depression auf. Sollten Sie Ihre Zahl für das kleine Spiel noch schätzen wollen, dann müssen Sie jetzt spätestens ihren vermuteten Wert aufschreiben, sonst wird gespoilert.
In diesem genannten Report ist zu lesen, dass Tod und Trauer in den USA damals bereits direkte Produktionsausfälle in Höhe von 75 Milliarden Dollar verursachten (entsprach ca. 18 Mrd. für D). Die Wirtschaftswoche beziffert am 8.11.2012 die Kosten für einen einzelnen Trauernden auf rund 16.000 Euro. Dass diese Zahlen sowohl entsprechend der Inflation als auch der Corona-Situation und einer ehedem stark geforderten persönlichen Resilienz, also der Kraft, gelassen mit derartigen Herausforderungen umzugehen, gestiegen sind, steht außer Frage.
Zusätzlich verschärft der bereits bestehende und noch wachsende Fachkräftemangel die Situation. Unternehmen, von denen im Internet erzählt wird, dass sie in solch sehr persönlichen Situationen ihre Mitarbeiter nicht unterstützen oder gar vor den Kopf stoßen, droht ein Bewerbermangel. Der aktuelle Gallup-Engagement-Index beziffert die Kosten für Mitarbeiter, die innerlich gekündigt haben, auf zwischen 92 und 115 Mrd. Euro pro Jahr. Zwei Drittel derjenigen, die nur noch eine geringe Bindung an das Unternehmen haben, gaben bei Gallup an, dass sie das Unternehmen in den kommenden drei Jahren verlassen haben werden. Je geringer hier die Bindung, desto höher ist die Wechselbereitschaft.
Auch ist nicht auszuschließen, dass die Berufsgenossenschaften den Unternehmen kritisch auf den Zahn fühlen, wenn ein fehlender Umgang mit dem Thema „Tod und Trauer“ Auslöser für einen Arbeitsunfall oder gar mehr sein könnte. Immerhin scheint es ja so zu sein, dass nachrückende Aufsichtspersonen oftmals eher einen psychologischen denn einen technischen Ausbildungshintergrund mitbringen.
Spürbar Hilfe anbieten
Weder Tod noch Trauer sind ansteckende Krankheiten. Vielmehr sind sie für alle Menschen ein chaotischer und schmerzhafter Moment, in dem sich das Leben neu ordnet. In aller Regel sind praktische Hilfsangebote willkommen – die meisten Mitarbeiter würden jedoch nie von sich aus danach fragen beziehungsweise darum bitten. Unternehmer, die in dieser existenziellen Krise ihren Mitarbeitern spürbar Hilfe anbieten, reduzieren ihre Ausfallkosten, stärken das Miteinander und tragen so aktiv und nachhaltig zur Bindung von gesuchten Fachkräften an ihre Firma bei. Hier kommt also neben dem Finanzbereich auch der Personalbereich auf seine Kosten.
Was können Fachkräfte für Arbeitsschutz tun?
Gute und günstige Arbeitssicherheit beginnt wie immer bei der Präventionskultur des Unternehmens. Konkret könnte von Seiten der Sifa mit der Geschäftsleitung eine ganzheitliche Perspektive beim Umgang mit Tod und Trauer begründet werden, wenn diese nicht schon anderweitig Teil des Unternehmensleitbildes ist oder dort einfach integrierbar gelebt wird.
Im Unternehmen könnte man auch in Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat folgende Botschaft festlegen, diese durch alle Hierarchien kommunizieren und entsprechend in das Bewertungs-/Bonussystem für die Führungskräfte einflechten: „Der wertschätzende Umgang mit Tod, Trauer und Trauma ist immer Teil auch der Arbeit in unserem Unternehmen – nie alleine Privatsache des Mitarbeiters.”
In der Regel treten diese Situationen überraschend auf. Erfahrungsgemäß sind Führungskräfte schon von dem Anlass alleine überfordert, und manche versuchen der Situation, die für sie nicht beherrschbar erscheint, auszuweichen. Das wäre aber nicht im Sinne des Arbeitsschutzes und erst recht nicht im Sinne des Unternehmens oder des betroffenen Mitarbeiters.
Der schwarze Brandschutzordner
Hilfreich ist zunächst eine Art „schwarzer Brandschutzordner“ mit firmenintern abgestimmten Alarm- bzw. Ablaufplänen, diese sind nach Anlass geordnet. Damit wäre auch kommuniziert, dass ein positiv-aktiver Umgang mit dem Thema „Tod und Trauer“ im Unternehmen kein Tabu, sondern gewünscht ist. Ein Hinweis auf die Berücksichtigung eines unterstützenden Verhaltens der Führungskraft beim nächsten Jahresgespräch würde dies noch mal verstärken. In einem solchen „schwarzen Brandschutzordner“ erfährt die Führungskraft auf einen Blick, wen sie wie informieren muss oder auch, wer für sie in diesem Moment unterstützend sein kann. Hilfreich ist zudem eine vorstrukturierte kleine Rede, die verwendet werden kann, um den Kollegen die Todesnachricht zu überbringen oder auch den Hinterbliebenen zu kondolieren. Hier kann sich eine Führungskraft anhand eines Flussdiagramms schnell einen Überblick verschaffen, wie sie zu Gunsten des Mitarbeiters reagieren kann – auch in welchem Rahmen sie nach Ermessen eigene Entscheidungen treffen kann, wie z. B. bis zu drei Wochen Sonderurlaub zu geben und mit dem Mitarbeiter im Gespräch zu bleiben – anstatt der sonst weit verbreiteten längeren Krankschreibung und dem Abtauchen des Mitarbeiters.
Regelmäßige Impulse für Führungskräfte
Ein monatliches Dreißig-Minuten-Webinar, exklusiv für Führungskräfte, hält die Informationen wach bzw. ergänzt sie. Vielleicht entsteht daraus im Anschluss auch ein firmeneigenes Wiki, hier würde die Führungskraft Ideen finden, die für den konkret Trauernden oder das Team hilfreich sind.
Kollegiale Ersthelferteams
Ein anderer Impuls, initiiert und ausgebildet durch die Fachkraft für Arbeitssicherheit, sind „Kollegiale Ersthelferteams“. Sie wurden von Dipl.-Ing. Heinke Wedler bereits vor mehr als einem Jahrzehnt in Kliniken für Situationen nach einem Übergriff eingeführt. Ihre Aufgabe ist es, die ihnen oft zumindest flüchtig bekannten Kollegen und Kolleginnen zu unterstützen, sodass diese aus der Schockphase wieder in die volle Selbstwirksamkeit gelangen, oder in Absprache mit dem Betriebsarzt und der Berufsgenossenschaft möglichst schnell die fünf probatorischen Sitzungen nach Arbeitsunfall über die Berufsgenossenschaft in Anspruch nehmen können. Dieser Aspekt ist darüber hinaus wichtig, da die Wartezeiten bei Psychologen aktuell bereits mehrere Monate betragen. Für diese Teams sind nach einer Erstausbildung verpflichtende regelmäßige Schulungen wichtig, um im Training zu bleiben. Sie fördert zudem auch weiterhin die Bereitschaft für diese ehrenamtliche Tätigkeit im Unternehmen. Wird ein solcher Dienst im Unternehmen eingerichtet, ist eine Supervision nach einem Einsatz unerlässlich.
Nachsorge
Vielfach unterschätzt wird insbesondere nach einem Todesfall die Kommunikation im Unternehmen. Diese Aufgabe fällt normalerweise der Führungskraft zu, sie muss angemessen, wertschätzend und zeitnah erfolgen – aber bisweilen ist das offen. Nichts verwirrt mehr, als wenn man vom Tod des aktiven Kollegen aus der Zeitung erfährt oder letztlich, wie auch schon passiert, dass der Parkplatz über Nacht neu vergeben war.
Große Unternehmen haben oftmals ihre regelmäßigen Prozesse standardisiert. Dazu zählt auch die Weihnachtspost der Geschäftsleitung und die automatisierte Versendung. Aber regelmäßig passiert der GAU: Die Witwe eines im November verstorbenen Mitarbeiters erhält Mitte Dezember eine standardisierte Weihnachtskarte, gegebenenfalls noch mit einem Präsent und auf jeden Fall mit fröhlichen Festtagswünschen.
Kommunikation
Auch ein wichtiger Aspekt ist das letzte Offboarding, die Kommunikation des Trauerfalls im Unternehmen, bei Kunden und Lieferanten und nicht zuletzt im Kontakt mit den Hinterbliebenen – erfahrungsgemäß wird dies von Kollegen häufig sehr genau beobachtet, es werden Rückschlüsse gezogen, die mancherorts zu Kündigungen auch langjähriger Fachkräfte geführt haben (alles schon erlebt).
Weitere Bausteine aus dem Blickwinkel Belastung/Gefährdung der Psyche könnten nach dem Ereignis sein: Welchen Umgang mit dem Tod oder welches Abschiedsritual könnte für ein Team wichtig sein? Hierbei sollten neben den Todesumständen und der Position des Verstorbenen auch gerade bei kleineren Gruppen die Kultur beziehungsweisedie religiösen Hintergründe der Beteiligten eine Rolle spielen. Diversity und Inklusion, gerade wenn man sich das als Unternehmen auf die Fahne geschrieben hat, stehen hier besonders im Fokus. Wenn beispielsweise ein Mitglied der Geschäftsleitung verstirbt, ist neben den vielen persönlichen Beziehungen auch von vielen Trauernden auszugehen. Hier sollte, wie vor einigen Jahren nach dem Suizid des Swisscom-Chefs Carsten Schloter, über eine Übertragung der Trauerfeier im Intranet nachgedacht werden. Bei einem schweren Arbeitsunfall mit einigen Toten und Schwerverletzten kann sehr wohl neben einem Abschiedsritual auch an eine „Hall of Fame“ bzw. Erinnerungskultur gedacht werden.
Einen guten, unterstützenden Abschluss einer Trauerphase könnte dann ein Vertrauens-Rückkehrgespräch sein, was ähnlich einem wertschätzenden BEM gestaltet werden könnte. Zu guter Letzt sollte natürlich nach jedem Ereignis eine Analyse erfolgen und gegebenenfalls die zuvor genannten Unterlagen ergänzt werden.
Autoren:
Dipl.-Ing. Heinke Wedler und Stefan Hund (Fachkraft für Arbeitssicherheit / Ev. Pfarrer i.R.)
Trauer im Unternehmen
Unterstützung bei Trauer im Unternehmen
Aufgrund von am Anfang zufälligen Anfragen nach auch natürlichen Todesfällen in Unternehmen („Sie sind doch auch Pfarrer und nicht nur Sifa, können Sie uns kurzfristig helfen?“), entwickelten Stefan Hund und Dipl.-Ing. Heinke Wedler ein eigenes Informations- und Angebotsportal zum Thema „Trauer in Unternehmen“. Hier finden Sie sowohl Informationen, um eigene Prozesse und Prozeduren für Trauerfälle in Unternehmen aufzubauen, als auch Unterstützung für Führungskräfte im Akutfall.