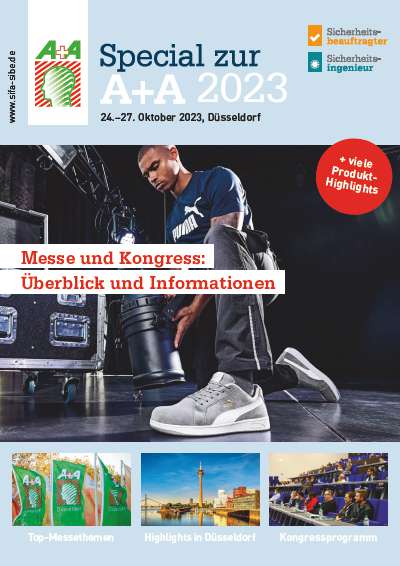Mit Inkrafttreten der Arbeitsschutzverordnung zu elektromagnetischen Feldern wurden Vorschriften zum Schutz der Sicherheit und Gesundheit von Beschäftigten für alle Tätigkeitsbereiche mit elektromagnetischen Feldern bis 300 GHz gesetzlich festgelegt. Zu diesen Vorschriften zählen auch die Anforderungen an die Beurteilung der Arbeitsbedingungen sowie die Festlegung, Durchführung und Wirksamkeitskontrolle von Maßnahmen zur Vermeidung
Unsere Webinar-Empfehlung
22.02.24 | 10:00 Uhr | Das Bewusstsein für die Risiken von Suchtmitteln am Arbeitsplatz wird geschärft, der Umgang mit Suchtmitteln im Betrieb wird reflektiert, sodass eine informierte Entscheidung über Maßnahmen zur Prävention von und Intervention bei Suchtmittelkonsum am Arbeitsplatz…
Teilen:










 SifaPlus-Beiträge und das große Archiv erhalten!
SifaPlus-Beiträge und das große Archiv erhalten!