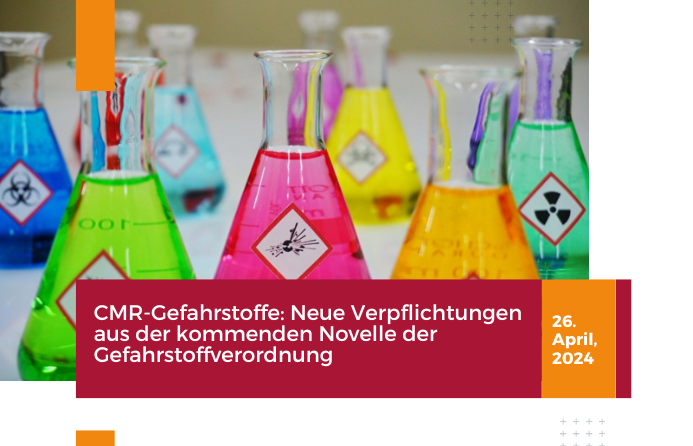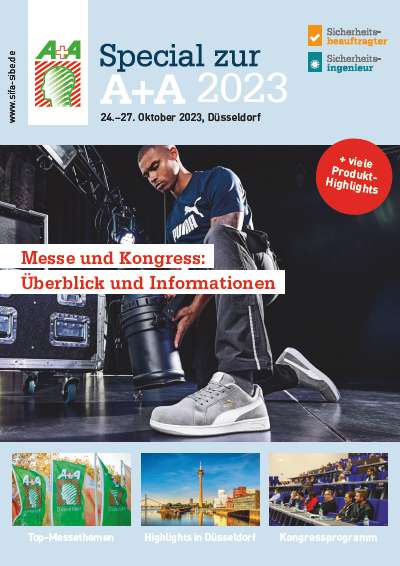Im Verbundprojekt ROKOKOde[1] werden insbesondere die arbeitswissenschaftlichen Aspekte der Mensch-Roboter-Kollaboration an Leichtbaurobotern untersucht. Das Projekt läuft bis Ende dieses Jahres. Peter Rally vom Fraunhofer IAO gibt erste Einblicke in die Erkenntnisse des Projekts – unter anderem darüber, ob Leichtbauroboter tatsächlich die „eierlegenden Wollmilchsauen“ sind, die Arbeitssicherheit, Mitarbeiterakzeptanz und wirtschaftliche
Unsere Webinar-Empfehlung
CMR-Gefahrstoffe der Kat. 1A oder 1B stellen unter den Gefahrstoffen die höchste Gesundheitsgefahr dar, weshalb die Gefahrstoffverordnung in § 10 besondere Schutzmaßnahmen für diese Stoffe vorschreibt.
Teilen:










 SifaPlus-Beiträge und das große Archiv erhalten!
SifaPlus-Beiträge und das große Archiv erhalten!