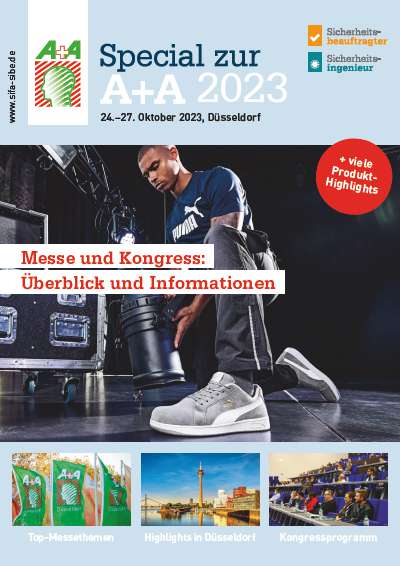Persönliche Schutzausrüstungen gegen die thermischen Auswirkungen eines Störlichtbogens (PSAgS) sind ein wichtiges Element des Schutzkonzepts für elektrotechnisches Personal. Diese Artikelserie soll für ein besseres Verständnis im Umgang mit PSAgS in der Praxis sorgen. Teil 2 zeigt, was sich in der Neufassung der DGUV Information 203–077 ändern wird.
Unsere Webinar-Empfehlung
Es gibt viele Fälle, in denen die Fallhöhe für eine herkömmliche Absturzsicherung nicht ausreicht. Beispiele für Arbeiten in geringer Höhe sind z.B. der Auf- und Abbau von Gerüsten, die Wartung von Industrieanlagen und Arbeiten in Verladehallen sowie Anwendungen in der Bahn und…
Teilen:










 SifaPlus-Beiträge und das große Archiv erhalten!
SifaPlus-Beiträge und das große Archiv erhalten!