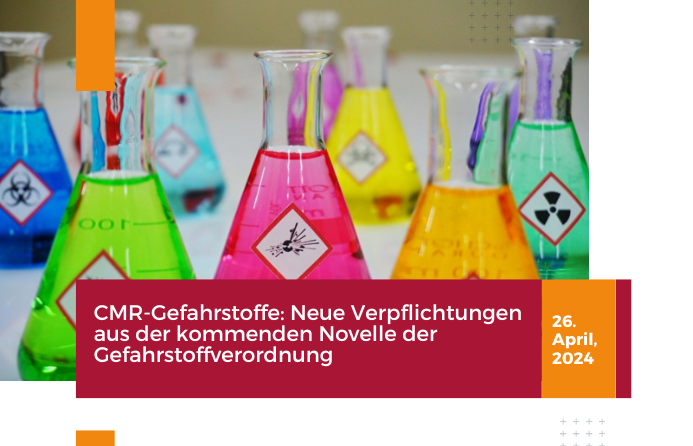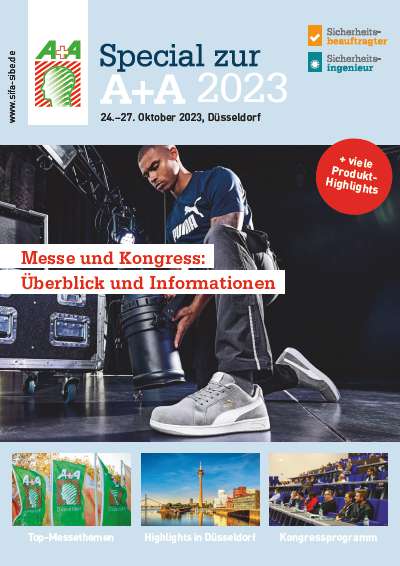Im Februar 2016 trat die Norm DIN VDE 0100–420 „Errichten von Niederspannungsanlagen, Teil 4–42: Schutzmaßnahmen – Schutz gegen thermische Auswirkungen“ in Kraft. In ihr wurde erstmalig die Forderung erhoben, dass in bestimmten Anwendungsfällen die Stromkreise elektrischer Anlagen mit „Brandschutzschaltern“de.kim.content.generate.input.Fnote@2ca5912a ausgestattet sein müssten (siehe SI 03/2017). Die Folge war vielerorts ein
Unsere Webinar-Empfehlung
CMR-Gefahrstoffe der Kat. 1A oder 1B stellen unter den Gefahrstoffen die höchste Gesundheitsgefahr dar, weshalb die Gefahrstoffverordnung in § 10 besondere Schutzmaßnahmen für diese Stoffe vorschreibt.
Teilen:











 SifaPlus-Beiträge und das große Archiv erhalten!
SifaPlus-Beiträge und das große Archiv erhalten!