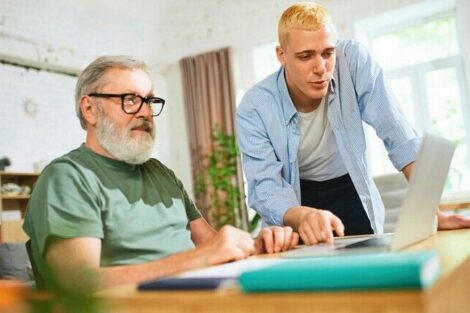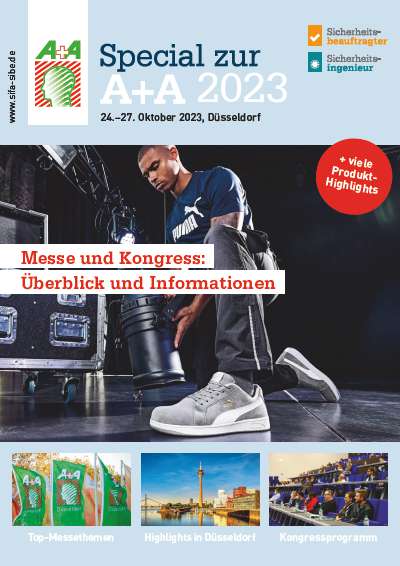Mit ihrer Kampagne „kommmitmensch“ machen die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) und die Unfallversicherungsträger Mut für eine wirklich nachhaltige und ganzheitliche Präventionskultur. Die Fachkräfte für Arbeitssicherheit sehen sie dabei als wichtige Partner, um Arbeitsschutz und Gesundheit in den Betrieben umfassend umzusetzen. Wir sprachen über die Ziele und Hintergründe der Kampagne
Unsere Webinar-Empfehlung
15.06.23 | 10:00 Uhr | Maßnahmenableitung, Wirksamkeitsüberprüfung und Fortschreibung – drei elementare Bausteine in jeder Gefährdungsbeurteilung, die mit Blick auf psychische Belastung bislang weniger Beachtung finden.
Teilen:












 SifaPlus-Beiträge und das große Archiv erhalten!
SifaPlus-Beiträge und das große Archiv erhalten!