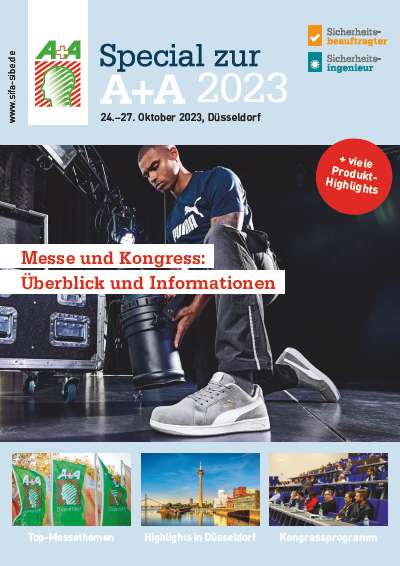Wenn es brennt, wollen alle eins: raus! Dafür gibt es oft nur einen sicheren Ausgang, den Notausgang. Dieser muss unbedingt immer frei gehalten werden. Und er darf auch nicht verschlossen sein. Achtet ein Arbeitgeber nicht darauf, handelt er ordnungswidrig. Das kann sehr teuer werden.
Ob Verkehrswege, Rettungs-
Unsere Webinar-Empfehlung
22.02.24 | 10:00 Uhr | Das Bewusstsein für die Risiken von Suchtmitteln am Arbeitsplatz wird geschärft, der Umgang mit Suchtmitteln im Betrieb wird reflektiert, sodass eine informierte Entscheidung über Maßnahmen zur Prävention von und Intervention bei Suchtmittelkonsum am Arbeitsplatz…
Teilen:











 SibePlus-Beiträge und das große Archiv erhalten!
SibePlus-Beiträge und das große Archiv erhalten!